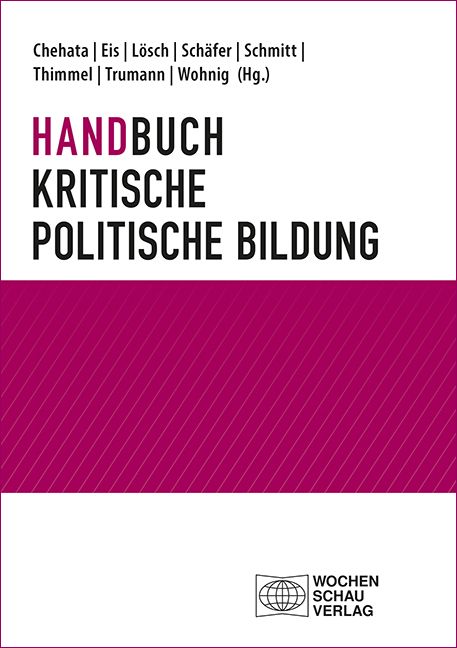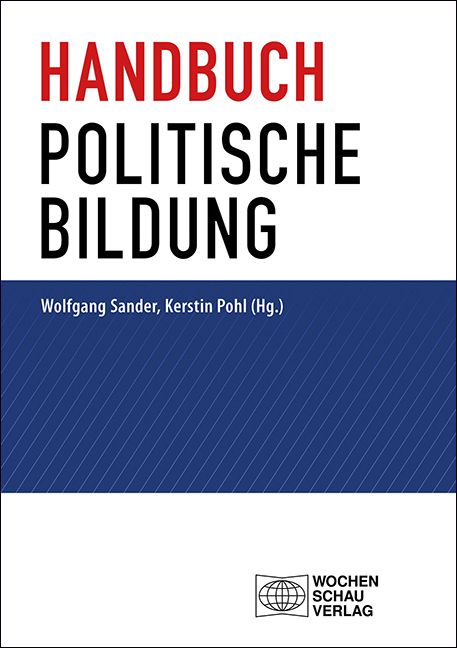Demokratie erfahren
Analysen, Berichte und Anstöße aus dem Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“
- herausgegeben von
- Wolfgang Beutel, Peter Fauser
- unter Mitarbeit von
- Rolf Bauer, Wolfgang Beutel, Bodo von Borries, Claudia Buchartowski, Monika Buhl, Peter Fauser, Arila Feurich, Mario Förster, Christa Goetsch, Hildegard Hamm-Brücher, Werner Hillen, Gerhard Himmelmann, Dorothea Kröll, Reinhard Künnemann, Christoph Lindenmeyer, Dagmar Luther, Hans Maier, Holger Möller, Veit Polowy, Michael Rump-Räuber, Fabian Sauer, Andre Frank Seegers, Hans-Wolfram Stein, Antje Strobel, Heinfried Tacke, Thomas Thieme, Susanne Thiele, Brigitte Vogt Sasse, Michaela Weiß, Wolfgang Wildfeuer, Angelika Wolters
Demokratisches Handeln ist die Grundlage für den Erhalt und die Erneuerung demokratischer Verhältnisse – politisch wie pädagogisch. Demokratie und Politik lernen ist deshalb ohne Handeln und ohne die Erfahrungen, die daraus erwachsen, nicht möglich: Um Demokratie zu lernen, müssen wir Demokratie erfahren! Der Band bündelt Ergebnisse und Projektbeschreibungen aus dem Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ und ist zugleich Dokumentation der Fachtagung „Begeisterung für Demokratie. 20 Jahre Demokratisch Handeln“. Dabei werden Grundlagen und Grundfragen der Demokratiepädagogik angesproc…
| Bestellnummer: | 4677 |
|---|---|
| EAN: | 9783899746778 |
| ISBN: | 978-3-89974677-8 |
| Format: | Broschur |
| Reihe: | Politik und Bildung |
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
| Auflage: | 1 |
| Seitenzahl: | 392 |
- Beschreibung Demokratisches Handeln ist die Grundlage für den Erhalt und die Erneuerung demokratischer Verhältnisse – politisch wie pädag… Mehr
- Inhaltsübersicht I. Analysen, Befunde, Grundlagen Hildegard Hamm-Brücher: Warum Demokratisches Handeln in der Schule? Über die Erziehung zur… Mehr
- Autor*innen Rolf Bauer, Beratungslehrer am Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz; Leiter des schulinternen Präventions-Programms "Schlaue… Mehr
- Stimmen zum Buch "[Es] zeigt [sich], wie facettenreich der Band ist. [...] Die heterogene Zusammensetzung der Autorinnen und Autoren bringt e… Mehr
I. Analysen, Befunde, Grundlagen
Hildegard Hamm-Brücher: Warum Demokratisches Handeln in der Schule? Über die Erziehung zur Verantwortung in der Demokratie.
Wolfgang Beutel/Peter Fauser: Demokratie lernen als schulpädagogisches Problem. Pädagogische Grundlagen, Konzept und Erfahrungen des Förderprogramms Demokratisch Handeln
Peter Fauser: Begeisterung für Demokratie. Lernen, Schulentwicklung und Demokratiepädagogik Bodo von Borries: 1989 – Erinnerung für die Zukunft
Gerhard Himmelmann: Variationen politischer Bildung – aktuelle Entwicklungen in der fachdidaktischen Diskussion II. Demokratie praktisch.
Projektporträts
Thema: „Schulleben/ Schulpartnerschaft:
Wolfgang Wildfeuer/Rolf Bauer: Die „Schlaue Eule“. Gewaltprävention, Streitschlichtung im Kindergarten: Gymnasiasten und Vorschulkinder arbeiten zusammen
Heinfried Tacke /Hemut Kopecki/Fabian Sauer: Wie Jugendliche selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen – Schulgestaltung als Zeichen gelebter Demokratie
Thema: „Zusammenleben“
Hans-Wolfram Stein/Holger Möller: Demokratisch Handeln durch politisches Schultheater. Romeo und Julia am SZ Walliser Straße in Bremen
ans-Wolfram Stein/Gitta Vogt-Sasse: Das Projekt „Computersucht: Virtuelle Welten“. Schulprojekte als Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen
Thema: „Kommune“
Werner Hillen/Dorothea Kröll: Mit Courage zur Stadt ohne Rassismus
Thema: „Ökologie – Welt und Umwelt“:
Mario Förster/Antje Strobel: Rettet die vogtländische Flussperlmuschel
Veit Polowy /Andre Seegers: Das Projekt „Licht für Lupila“
Thema: „Geschichte – Gedenken und Erinnern“
Dagmar Luther/ Susanne Thiele/Thomas Thieme: Historische Orte in Weimar 1919 zur Zeit der Nationalversammlung. Ein interaktiver Stadtrundgang von Schülern für Schüler
Claudia Buchartowski/ Reinhard Künnemann/Angelika Wolters: Deportiert – Ausgebeutet – Vergessen: Ahlener Schülergruppe erforscht Schicksale italienischer Zwangsarbeiter
III. Schulentwicklung, Förderung und Perspektiven
Heinfried Tacke: Proben des Politischen und der Demokratie. Eine Binnenansicht auf die Lernstatt Demokratie
Michaela Weiß/Wolfgang Beutel: Demokratie-Akzeptanz und Politische Identitätsbildung. Ergebnisse aus der Begleituntersuchung zur Lernstatt Demokratie
Wolfgang Beutel/Arila Feurich/Heinfried Tacke: Schulentwicklung und wissenschaftliche Begleitung vor Ort. Die regionale Beratung im Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“
Wolfgang Beutel/Veit Polowy/Heinfried Tacke: „Begeisterung für Demokratie? Erziehung vor und nach der Wende – Fragen an Politik und Pädagogik“ Eine Reportage zur Tagung 20 Jahre Demokratisch Handeln
Michael Rump-Räuber: Demokratische Schulentwicklung als Thema und Aufgabe der deutschen Wiedervereinigung
IV. Der Hildegard-Hamm-Brücher-Förderpreis
Peter Fauser: Demokratie ist kein vorgegebener Natursachverhalt, sondern eine uns Menschen mitgegebene Möglichkeit ¬– Preisbegründung sowie Laudatio auf Wolfgang Edelstein und Eva Madelung
Christa Goetsch: Als Bürger für Bürger Politik machen – Laudatio auf Henning Scherf
Hans Maier: Demokratie als Lebensaufgabe – Hommage an Hildegard Hamm-Brücher
Hildegard Hamm-Brücher im Gespräch mit Christoph Lindenmeyer: Die Demokratie – Ich kann davon einfach nicht lassen!
V. Dokumentation
Rolf Bauer, Beratungslehrer am Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz; Leiter des schulinternen Präventions-Programms "Schlaue Eule".
Wolfgang Beutel, Dr. phil., Geschäftsführer des Wettbewerbs „Förderprogramms Demokratisch Handeln“; Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und päd. Experte beim Deutschen Schulpreis.
Bodo von Borries, Dr.; Historiker, Geschichtslehrer und Geschichtssdidaktiker; bis 2008 Professor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Geschichte an der Universität Hamburg.
Claudia Buchartowski, Lehrerin an der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen; Didaktische Leitung der Schule und für die Betreuung, Koordination und Weiterentwicklung der pädagogisch-didaktischen Arbeit zuständig.
Peter Fauser, Dr. rer. soc.; Universitätsprofessor für Schulpädagogik und Schulentwicklung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena; Vorsitzender der Akademie für Bildungsreform; wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“; des Entwicklungsprogramms für Unterricht und Lernqualität (E.U.LE) und Initiator der IMAGINATA in Jena; Gutachter des BLK-Programms „Demokratie lernen & leben“; Mitbegründer des Deutschen Schulpreises.
Arila Feurich, M.A. Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie; Wiss. Mitarbeiterin und Doktorandin der Friedrich-Schiller-Universität Jena; Seit 2010 Wiss. Mitarbeiterin beim Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“.
Mario Förster, M.A. Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft; Wiss. Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Göttingen; Seit 2010 Regionalberater Jurymitglied des Wettbewerbs „Förderprogramms Demokratisch Handeln“ für Niedersachsen.
Christa Goetsch, Studienrätin; Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft; Mitglied im Beirat des Wettbewerbs „Förderprogramms Demokratisch Handeln“; Mitglied im Beirat der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg; 2008 bis 2010 Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Schule und Berufsbildung in Hamburg.
Hildegard Hamm-Brücher, Dr. Dr. h.c.; Staatsministerin a.D.; Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende der Theodor-Heuss- Stiftung; Vorsitzende des Beirates des Wettbewerbs „Förderprogramms Demokratisch Handeln“; Auslobung des „Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für Demokratie lernen und erfahren“; Kuratoriumsmitglied am Jüdischen Zentrum München; Ehrenmitglied des Vereins „GesichtZeigen Für ein weltoffenes Deutschland e. V.“.
Werner Hillen, Rektor der Edith-Stein-Schule Friedrichsthal; Projektleiter der Projektgruppe „Gegen Rassismus und Gewalt“; Auszeichnung durch den Kinderschutzbund; Auszeichnung mit der Friedrich-Schlomo-Rülf-Medaille; ab 2013 Regionalberater des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ für das Saarland.
Gerhard Himmelmann, Dr. rer. pol.; Professor für Politische Wissenschaft und Politische Bildung i.R.; bis 2009 Vorstandsmitglied in der DeGeDe; Jurymitglied Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“.
Dorothea Kröll, freiberufliche systemische Beraterin und Lehrerin; bis 2005 Projektberaterin und Geschäftsführerin des Vereins Praktisches Lernen und Schule - PLUS e.V.; Region Kassel; seit 2009 ehrenamtliche Regionalberaterin und Jurymitglied des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ in Hessen.
Reinhard Künnemann, Lehrer an der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen; Tutor mehrerer lokal und regional orientierter SchülerInnen-Projekte zu Themen „Opfergruppen im Nationalsozialismus“ sowie „Formen des Rassismus heutzutage“.
Christoph Lindenmeyer, Freier Autor und Honorarprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg; langjähriger Leiter der Hauptabteilung Kultur im Bayerischen Rundfunk und Programmkoordinator Bayern 2; Mitglied des deutschen PEN-Zentrums; Dozent an der Deutschen Journalistenschule; Vorsitzender des Verwaltungsrats des Evangelischen Presseverbands für Bayern und des Kuratoriums „Freunde der Monacensia“ (München); Mitglied der Medienpreis-Jury „Robert Geisendörfer Preis“.
Dagmar Luther, Fachlehrerin für Geschichte und Englisch; Fachberaterin für Geschichte am Staatlichen Schulamt Mittelthüringen seit 2000. Mail:
Hans Maier, Prof. Dr. phil.; Politikwissenschaftler und Politiker; bayerischer Staatsminister für Kultus und Unterricht a.D.; u.a. Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung; Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste; Vorsitzender des Kuratoriums der Akademie für Politische Bildung Tutzing.
Holger Möller, Lehrer für Theater, Wirtschaft und Persönlichkeitsbildung an der Gesamtschule Bremen-Ost und der Hochschule Bremen.
Veit Polowy, M.A. Soziologie, Erziehungswissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie derzeit Doktorand an der Universität Leipzig; Vorsitzender der Initiative Bildung in Zukunft e.V. (IBiZ).
Michael Rump-Räuber, Lehrer und Historiker; Referent im Aufgabenfeld Gewaltprävention, Demokratiepädagogik, Antisemitismus, Politischer Extremismus am LISUM Berlin-Brandenburg.
Fabian Sauer, Geschäftsführer der mecodia GmbH, Student der Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, Mitglied des Vorstands des Vereins „Medienkompetenz 2.0 e.V.“.
Andre Frank Seegers; Oberstudienrat am Gymnasium Blankenese, Hamburg, mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Theater; Koordinator für Schulpartnerschaften und Interkulturelles Lernen; Projektleiter der Arbeitsgruppe "Lupila".
Hans-Wolfram Stein, bis 2010 Lehrer für Politik und Wirtschaft in Bremen und bis 2011 Regionalberater Bremens und Jurymitglied beim Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“.
Antje Strobel, Lehrerin an der Schiller-Grundschule Rodewisch; verschiedene Preise für Projektarbeiten u.a. „Henne Henriette“ und „Die vogtländische Flussperlmuschel“.
Heinfried Tacke, Dipl. Päd.; Freier Journalist im Bildungsbereich; Schwerpunkt Schule und Jugend, langjähriger Mitarbeiter des Förderprogramms „Demokratisch Handeln“.
Thomas Thieme, Lehrer für Mathematik und Physik; Koordinator für Fort- und Weiterbildung und Demokratiepädagogikberater am Staatlichen Schulamt Mittelthüringen; seit 2007 Regionalberater des Wettbewrbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ in Thüringen.
Susanne Thiele, Lehrerin für Deutsch und „Darstellen und Gestalten“ am Goethegymnasium Weimar, Durchführung eines Modellprojektes zur Einführung des Faches Darstellen und Gestalten in die Thüringer Oberstufe und Entwicklung des Lehrplans für das Fach Darstellen und Gestalten an Thüringer Gymnasien.
Brigitte Vogt Sasse, Didaktische Leiterin des beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales am Schulzentrum der Sekundarstufe II Neustadt in Bremen, Arbeitsschwerpunkt im Profilfach Pädagogik / Psychologie.
Michaela Weiß, M.A. Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft, Psychologie; Seit 2009 wiss. Mitarbeiterin und Doktorandin an der Georg-August-Universität Göttingen; Seit 2010 Regionalberaterin des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ für Niedersachsen dort Jurymitglied.
Wolfgang Wildfeuer, Dr.; Referent im Sächsischen Bildungsinstitut (SBI) Radebeul, Arbeitsschwerpunkte: externe Schulevaluation; Regionalberater des Wettbewerbs „Förderprogramms Demokratisch Handeln“ in Sachsen; päd. Experte und Mitglied des Regionalteams Ost beim Deutschen Schulpreis;
Angelika Wolters, Dr. phil.; Referentin für Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung im Kultusministerium Sachsen-Anhalt; Jurymitglied und bis 2011 Regionalberaterin für den Wettberwerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ in Sachsen-Anhalt; pädagogische Expertin des Deutschen Schulpreises; Vorstandsmitglied des Ganztagsschulverbandes Sachsen-Anhalt.
"[Es] zeigt [sich], wie facettenreich der Band ist. [...] Die heterogene Zusammensetzung der Autorinnen und Autoren bringt eine Vielfalt an Textarten, Perspektiven und Intentionen mit sich. [...] Somit bietet der Sammelband einerseits für die wissenschaftliche Rezeption reichlich Ansätze zur (in Teilen sicherlich auch kritischen) Auseinandersetzung mit [...] der Demokratiepädagogik [...]. Andererseits erhalten vor allem auch Pädagoginnen und Pädagogen, die für die Umsetzung demokratiepädagogischer und -didaktischer Konzepte in der Bildungspraxis die zentralen Personen sind, vertiefte Einblicke [...] und, si volunt, aktivierende Impulse".
Lehren & Lernen - Zeitschrift für Schule und Innovation aus BW
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Der Band verfolgt das Anliegen, die Debatten um das Erlernen bürgerschaftlicher und demokratischer Kompetenzen, um Schulöffnung und Schulentwicklung sowie die Frage danach, was moderne Bildung heute ausmacht und welcher Stellenwert dabei dem bürgerschaftlichen Engagement zukommt, zusammen zu führen. Dazu werden in systematischer Form Beiträge versammelt zu: theoretischen Zugängen und Leitbildern, pädagogischen Konzepten und Reformmodellen, Methoden, Handlungsfeldern und Akteuren der Engagement- und Demokratieförderung in und mit Schulen. Das Buch bietet in dieser Gesamtschau eine Einschätzung der Relevanz bürgergesellschaftlicher Reformansätze für das Schulsystem, skizziert den erreichten Entwicklungsstand und beschreibt Perspektiven und Herausforderungen in Bildungspolitik und Bürgergesellschaft.
Das aktuelle Jahrbuch Demokratiepädagogik behandelt zwei unterschiedliche Schwerpunktthemen: "Neue Lernkultur" und "Genderdemokratie". Zahlreiche Expertinnen und Experten beleuchten die Themen unter demokratiepädagogischen Fragestellungen. Besonders interessant sind auch diesmal wieder die Praxisberichte. Daneben finden regionale und länderübergreifende Aspekte ebenso, wie Rezensionen neuester Literatur und ein Dokumentationsteil.
An vielen Lernbiografien lässt sich die Verknüpfung von Tests, Noten, Zensuren und Versetzungen bzw. Schullaufbahnentscheidungen mit der Wahrnehmung von Druck, partiellem Versagen, möglicherweise von Diskriminierung und Ausgrenzung aufzeigen. Klassenarbeiten und Zensuren korrespondieren mit Selbstkonzepten und Selbstbildern sowie damit, ob und wie sich Kinder und Jugendliche in der Schule gerecht (oder auch ungerecht) behandelt fühlen. Der mit Leistungsbeurteilung verbundene Umgang mit Kriterien der Gerechtigkeit sowie die Spannung von Erwartung auf Anerkennung und praktischer Schulerfahrung haben Einfluss darauf, wie Schülerinnen und Schüler selbst in Blick auf Gerechtigkeit, auf Anerkennung, auf Toleranz, aber auch auf Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft mit sich und mit anderen umgehen. Sie sind daher Beitrag und Element des Lernens von und für die Demokratie. Der Band möchte diese fundamentale Dimension von Schule aufnehmen und unter dem Spannungsfeld von „Bewertung und Beteiligung“ diskutieren. Er soll die Debatte um die Leistungsbeurteilung mit der Frage der Demokratiepädagogik verbinden. Die Fülle an Zusammenhängen zwischen Leistungsbeurteilung und Demokratielernen ist offenkundig: In drei Teilen werden Grundfragen erörtert, Praxiserfahrungen erkundet und schulische Kontexte diskutiert.
Politik und Bildung
Partizipation in der Demokratie basiert auf Grundlagen, die zugleich Ziel und Selbstverständnis politischer Bildung sind: Subjektorientierung, freie Urteilsbildung, Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Indoktrinationsverbot, Konflikt- und Kontroversitätsorientierung. Sie bedarf aber auch einer demokratisch gesinnten Bevölkerung, die durch ihre Partizipation Demokratie mitgestaltet, weiterentwickelt und für sie einsteht.Was bedeutet es angesichts dieser gegenseitigen Angewiesenheit für die politische Bildung, wenn sich die Formen demokratischer Herrschaft in einem rasanten Wandel befinden?Der Band beleuchtet eine Vielzahl von Entwicklungen der letzten Jahren, die einerseits unsere Demokratie verändern, andererseits aber auch neue Formen von Beteiligung hervorbringen. Herausgekommen ist eine Standortbestimmung der politischen Bildung, die den Auftrag, alle Menschen mitzunehmen und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, ernst nimmt.
Der Sammelband gibt einen Überblick zur politischen Bildung in Grundschule und Sachunterricht. Darüber hinaus werden ausgewählte Aufgaben- und Inhaltsfelder praxisnah vorgestellt.
Wie man die Leitidee nachhaltiger Entwicklung in der Berufsbildung erschließt und was politische Bildung dazu beitragen kann, stellen Expert:innen multiperspektivisch und mit praktischen Tipps in dem neuen Handbuch vor.
Die Transformation des Sozialstaates hat Soziale Arbeit in Europa entscheidend verändert. Die Politik des „Schirms“ soll als Mechanismus wirken, der gesellschaftliche Reichtum umverteilt werden. Zentrale Ideen eines sozialen Europas geraten dabei ins Hintertreffen. Die Beiträge zu Kernthemen Sozialer Arbeit in diesem Buch sind verbunden mit den Stichworten sozialpädagogischer Dienst, europäisches Sozialmodell, Kinderschutz, soziale Fürsorge, Institutionsentwicklung, Jugendstrategien, Gegenentwürfe zum Neo-Liberalismus und Ökonomie. Dabei wird deutlich, dass sozialstaatliche Grundlagen und Prämissen in allen europäischen Ländern prekär werden und die Arbeitsbedingungen von Sozialer Arbeit beeinflussen. Ohne eine europäische „Klagemauer“ einzurichten, werden wesentliche Aspekte der Sozialen Arbeit in den europäischen Ländern Deutschland, England, Griechenland, Litauen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn kritisch diskutiert.
Angesichts des demografischen Wandels mit einem wachsenden Anteil zugewanderter Bevölkerung in Deutschland gewinnt die Beschäftigung mit dem Themenkomplex "Migration und Familie" zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund bietet das vorliegende Handbuch einen wichtigen Überblick über die bislang eher verstreuten Untersuchungen aus den verschiedenen Fachdisziplinen. Neben den sozialpädagogischen werden auch historische, rechtliche, psychologische und theologische Aspekten der Thematik behandelt. Ein besonderes Interesse gilt dabei der Frage, wie sich Migrationsprozesse auf die Bevölkerungs- und Familienstruktur sowie die Integrationspolitik auswirken. Auch stellen die Autorinnen und Autoren sozialpädagogische Handlungsfelder und deren Qualitätsanforderungen vor. Das Handbuch ist als Nachschlagewerk und Studienbuch mit grundlegenden theoretischen Artikeln zu den Themen Migration und Familie sowie zu praktischen Ansätzen und Modellen konzipiert. Dies macht eine theoriegeleitete Praxis möglich. Das Buch richtet sich u.a. an Studierende der Erziehungswissenschaft, der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Heilpädagogik und der Sozialen Arbeit; Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, Erwachsenenbildnerinnen und -bildner sowie Multiplikatoren in der Elternarbeit.
Der Sammelband präsentiert Einblicke in die Erforschung von Institutionen und Praktiken der non-formalen Bildung und rückt insbesondere das Verhältnis von Bildung, Bildungsarbeit und Jugendpolitik ins Zentrum.
Eine reflexive politische Bildung zielt auf Mündigkeit ab. In diesem Buch wird eine reflexive politische Bildung in Theorie, Didaktik und Praxis skizziert, die an einer Förderung von Denk-, Handlungs- und Urteilsmöglichkeiten orientiert ist. Dafür werden didaktische Spannungsfelder in ihrer Verbundenheit mit normativen Annahmen diskutiert. Die praktische Umsetzung reflexiver Bildungserfahrungen wird im Blick auf den sozialwissenschaftlichen Unterricht sowie auf die Antisemitismusprävention in der Schule betrachtet. Im Ergebnis zeigt sich: Mündigkeit in der politischen Bildung kann nicht garantiert, aber organisiert und unterstützt werden.
Das Lehrbuch bietet – nunmehr in der dritten, vollständig überarbeiteten Auflage – einen Überblick über die Grundlagen und wichtigsten Handlungsansätze der Sozialraumorientierung. Dazu werden ihre Theorien, Methoden und konträren Positionen auf dem heutigen Stand der Diskussion dargestellt. Wer beruflich, im Rahmen seines Studiums oder der ehrenamtlichen Arbeit mit der Sozialraumorientierung befasst ist, findet in dem Band vielfältige Aspekte, die jeweils theoretisch eingeordnet und in ihrer praktischen Bedeutung erläutert werden. Zentrale Themen sind dabei die Sozialraumorientierung als Konzept Sozialer Arbeit, Raumstrukturen und ihre aktuellen Trends, quantitative und qualitative Raumanalyse, Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement, die Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen, Netzwerkorientierung, kommunale Sozialpolitik und die Arbeit im öffentlichen Raum. Ergänzt um Wiederholungsfragen und kommentierte Literaturangaben, enthält das Buch in kompakter Form die wesentlichen Informationen für alle, die an Theorie und Praxis der Sozialraumorientierung interessiert sind.
Ist unsere Demokratie angesichts andauernder politischer Krisen in Europa und der Welt sowie im Lichte des zunehmenden Populismus bereits eine „Angegriffene Demokratie“? Wir gehen davon aus, dass Demokratie nicht ohne die Integration und den Schutz von Minderheiten, nicht ohne Toleranz und nur mit einem wirksamen Bekenntnis zur universellen Gültigkeit der Menschenrechte lebendig ist und bleibt. Hierfür benötigt sie Lernen und Bildung. Das Buch widmet sich nebst perspektivischen Diagnosen zum Zustand der Demokratie der Frage, was eine „Bildung für Demokratie“ aktuell bedeuten kann.
Beratung im Kontext Rechtsextremismus unterstützt Menschen im Umgang mit extrem rechten und menschenfeindlichen Tendenzen. Der Band bietet einen Einblick in verschiedene Beratungsfelder, Methoden und Positionen dieser jungen Profession.
Ziel von Citizenship Education sind mündige Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die in der Lage sind, in bestehenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen zu agieren und darüber hinaus Herrschafts- und Machtstrukturen zu analysieren, sich ein kritisch-reflektiertes Urteil zu bilden und selbst aktiv politische Prozesse zu beeinflussen. Diskutiert wird dabei auch, wie soziale und politische Teilhabe ermöglicht und politikdidaktisch begleitet werden kann. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Fachdidaktik, der Menschenrechtsbildung und der Soziologie widmen sich Lehrkräfte und politische Bildnerinnen und Bildner aus der außerschulischen Praxis in diesem Band den (globalen) Herausforderungen gelingender Demokratiebildung. Auch Schülerinnen und Schüler kommen in einem Gastbeitrag zu Wort. Das Grundlagenbuch richtet sich an alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der Lehrkräftebildung.
Die Autorinnen und Autoren der Publikation diskutieren das Verhältnis von Emanzipation und politischen Bildungsprozessen und setzen sich aus verschiedenen Teilbereichen und Disziplinen (u.a. demokratietheoretisch, sozioökonomisch, lebensweltlich, exklusionskritisch, bildungspraktisch) mit didaktischen Konzepten um Mündigkeit und Aufklärung auseinander.Mündigkeit als Ziel politischer Bildung spiegelt sich am Begriff „Emanzipation“. Doch wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskurse in den didaktischen Strategien wider? Welche Konzepte mündiger BürgerInnenschaft werden verhandelt und welche Herausforderungen ergeben sich im Kontext von Unmündigkeit und kritischer Subjektbildung?Das Grundlagenbuch vereint Beiträge aus Wissenschaft, Hochschullehre und Unterrichtspraxis und richtet sich an Lehrkräfte, MultiplikatorenInnen und DozentInnen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der LehrerInnenbildung.
Welchen Beitrag kann Soziale Arbeit in der Schule leisten, damit Vielfalt im Sinne der unterschiedlichen Ressourcen und Potenziale von Kindern und Jugendlichen im schulischen Alltag anerkannt und gefördert wird, schulinterne Ausgrenzung vermieden und eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung für alle angestrebt wird? Dieser Frage widmet sich der vorliegende Sammelband. Alle bisher erschienenen international vergleichenden Schulleistungsstudien kommen im Hinblick auf das deutsche Bildungssystem zu dem Ergebnis, dass der Bildungserfolg stark vom sozioökonomischen Hintergrund der Kinder und Jugendlichen abhängt. Es lassen sich Selektionsmechanismen im Bildungswesen identifizieren, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht angemessen gefördert werden und Bildungskarrieren scheitern. Zugleich wird Schule durch kulturelle und soziale Heterogenität geprägt, mit der sich alle Beteiligten konfrontiert sehen. Die Auseinandersetzung mit Diversität und Disparität ist daher eine zentrale Aufgabe von Schule, die allerdings nicht allein durch die Fachkompetenz von Lehrern und Lehrerinnen zu bewältigen ist. Diese Erkenntnis hat einerseits dazu beigetragen, der Schulsozialarbeit einen gewissen Stellenwert zuzubilligen, aber andererseits noch nicht zu ihrer gesetzlichen Verankerung, soliden Finanzierung und flächendeckenden Verbreitung geführt. Zugleich sind die Aufgaben von Schulsozialarbeit zurzeit noch stark defizitorientiert und kompensatorisch definiert. In Abgrenzung davon wird hier ein ganzheitlicher, auf Ressourcen und Potenziale ausgerichteter sozialpädagogischer Ansatz und ein auf Teilhabe zielendes Bildungsverständnis vorgestellt. Wurden Themen wie Diversity und Inklusion bisher meistens allein aus Sicht der Schulpädagogik erörtert, liefert der vorliegende Band eine andere Perspektive. Hier wird die Soziale Arbeit im Kontext von Schule in den Mittelpunkt gerückt. Eine Diversity-Strategie in der Schule ermöglicht auch einen Paradigmenwechsel für Schulsozialarbeit, der in diesem Buch herausgearbeitet wird.
Welche Konsequenzen haben Diskurse zu Migration, Integration und Bildung für die Jugendarbeit? Wie können Strukturen und Angebote der Jugendarbeit im Kontext der Migrationsgesellschaft verändert und weiterentwickelt werden? Das Buch richtet sich sowohl an Forscher_innen, Studierende als auch an Praktiker_innen der Jugendarbeit und geht in kritisch-reflexiver Weise vor allem auf strukturelle Fragen der interkulturellen Öffnung ein. Vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse werden Fragen der Teilhabe und Partizipation von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aufgeworfen und Potenziale von Jugendarbeit für die Migrationsgesellschaft aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf Praxisforschungsprojekten in der verbandlichen und internationalen Jugendarbeit. Voraussetzungen und Prozesse interkultureller Öffnung werden dargestellt, Öffnungsstrategien thematisiert und künftige Aufgaben und Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis diskutiert. Leser_innen erhalten gebündelt den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung und des Diskurses zur Interkulturellen Öffnung in der Jugendarbeit als Anregung für die eigene Arbeit und als Anstoß für weitere Diskussionen.