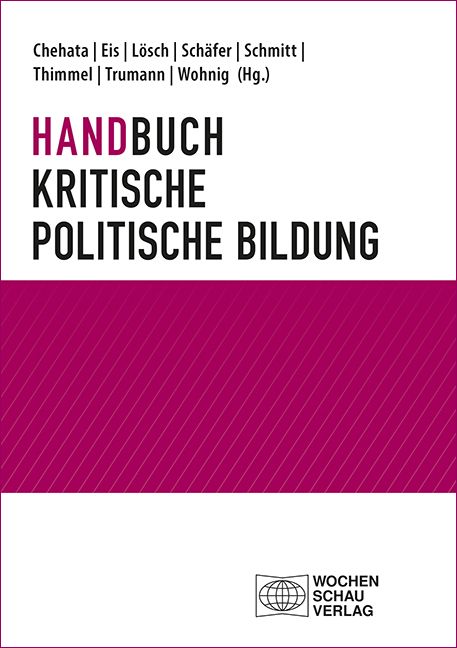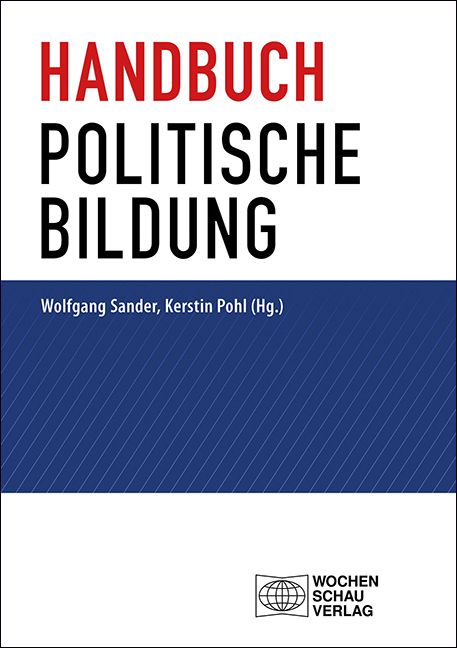Pragmatistische Politikdidaktik
Making It Explicit
- von
- Armin Scherb
Die Geschichte der Politischen Bildung in der Bundesrepublik hat Gesamtkonzeptionen hervorgebracht, deren philosophische Referenztheorien in den Jahren nach 1968 zu einer Lagerbildung geführt hatten. In der Zeit nach dem Beutelsbacher Konsens (1976), der als werthaltige Geschäftsordnung der Politischen Bildung den Richtungsstreit der nachachtundsechziger Jahre beendet hat, ereignete sich eine „Professionalisierung“, die auch mit einem Verzicht auf Theoriebildung einher gegangen ist. Walter Gagel hatte deshalb durchaus mit kritischem Unterton von einer „nachkonzeptionellen Phase“ (1994) gespro…
| Bestellnummer: | 4963 |
|---|---|
| EAN: | 9783899749632 |
| ISBN: | 978-3-89974963-2 |
| Format: | Broschur |
| Reihe: | Politik und Bildung |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Auflage: | 1. Auflage |
| Seitenzahl: | 288 |
- Beschreibung Die Geschichte der Politischen Bildung in der Bundesrepublik hat Gesamtkonzeptionen hervorgebracht, deren philosophische Ref… Mehr
- Inhaltsübersicht Einleitung 1. Was heißt „Pragmatismus“?2. Was muss eine „Pragmatistische Politikdidaktik“ leisten?3. Das Spannungsverhältnis… Mehr
- Autor*innen Dr. phil. Armin Scherb lehrt als Professor für Didaktik der Sozialkunde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn… Mehr
- Stimmen zum Buch "Mit Blick auf aktuelle fachdidaktische Diskussionen sei besonders hervorgehoben, dass im Entwurf der "Pragmatistischen Poli… Mehr
Die Geschichte der Politischen Bildung in der Bundesrepublik hat Gesamtkonzeptionen hervorgebracht, deren philosophische Referenztheorien in den Jahren nach 1968 zu einer Lagerbildung geführt hatten. In der Zeit nach dem Beutelsbacher Konsens (1976), der als werthaltige Geschäftsordnung der Politischen Bildung den Richtungsstreit der nachachtundsechziger Jahre beendet hat, ereignete sich eine „Professionalisierung“, die auch mit einem Verzicht auf Theoriebildung einher gegangen ist. Walter Gagel hatte deshalb durchaus mit kritischem Unterton von einer „nachkonzeptionellen Phase“ (1994) gesprochen. Nahezu gleichzeitig hatte er andernorts den „Pragmatismus als verborgene Bezugstheorie der politischen Bildung“ (1995) identifiziert. Disparate Beiträge zum Verhältnis von Pragmatismus und Politischer Bildung rücken jedoch die Frage in den Vordergrund, ob die von Gagel so bezeichnete „verborgene Bezugstheorie“ des Pragmatismus nicht überhaupt als Begründungskonzept für die Politische Bildung tauglich erscheint. Verschiedene Anläufe, den Pragmatismus auf der Basis der Erziehungsphilosophie von John Dewey hoffähig zu machen, waren nur mäßig erfolgreich, weil Deweys Konzept normativ zu schwach ist. Erfolg versprechender erscheint dagegen der Rekurs auf den Urvater des Pragmatismus C.S. Peirce, dessen pragmatistische Erkenntnistheorie beachtliche Relevanz für ein normatives Konzept der Politischen Bildung entfaltet, zumal im Pragmatismus à la Peirce eine Aufhebung anderer Bezugstheorien gelingen kann. Noch bevor der Terminus lebendig wurde, hat Peirce mit seiner Pragmatischen Maxime den linguistic turn vollzogen. Sein Pragmatismus kann somit auch konstruktivistische Elemente integrieren. Daraus ergeben sich interessante Ansätze für eine pragmatistische Grundlegung der Politischen Bildung, deren didaktische Säulen das Prinzip der Sinnorientierung, die Politische Urteilskompetenz als Problemlösungsprozess und die Offenheit von Schule sind.
Einleitung
1. Was heißt „Pragmatismus“?
2. Was muss eine „Pragmatistische Politikdidaktik“ leisten?
3. Das Spannungsverhältnis von Selbstbestimmung und normativer Bindung
TEIL I: Zur Rezeptionsgeschichte des Pragmatismus in Deutschland
1. Abwehr, Diskreditierung und Umdeutung
1.1 Instrumentalismus, Utilitarismus, Relativismus
1.2 Faschismus und Dezisionismus
1.3 Kognitionsfeindlichkeit
2. Die Rezeption in der Politischen Bildung nach 1945
2.1 Die „halbierte“ Pragmatismusrezeption bei Friedrich Oetinger
2.1.1 Kooperation, reflektierte Erfahrung und Übung
2.1.2 „Wahrheit“ als Ergebnis von Kooperation
2.1.3 Reduzierter Politikbegriff
2.1.4 „Halbierte“ Dewey-Rezeption und Reste der NS-Ideologie
2.2 Impliziter Pragmatismus in den politikdidaktischen Konzeptionen
2.2.1 Die zuerst „verdeckte“, dann eklektizistische Rezeption bei Hermann Giesecke
2.2.2 Rolf Schmiederers Schülerorientierung
2.2.3 Die versäumte Rezeption in der methodenorientierten Politikdidaktik bei Bernd Janssen
2.2.3 Näherungen an pragmatistisches Denken bei Bernhard Sutor und Wolfgang Sander
Exkurs 1: Der Pragmatismus der Radbruchschen Formel
Exkurs 2: Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus
2.3. Bekenntnisse zum Pragmatismus: Proklamation ohne (hinreichende) Explikation
2.3.1 Pragmatismusbezüge in Walter Gagels Didaktik
2.3.2 Pragmatismus in Tilmann Grammes‘ Kommunikativer Fachdidaktik
2.3.3 Gerhard Himmelmann: Pragmatismus als Implikation des Demokratielernens
TEIL II: Der Pragmatismus als explizite Bezugstheorie
1. Der Pragmatismus als allgemein-pädagogische Theorie des Lernens und der Schule
1.1 Deweys Begriff der Erfahrung
1.2 Pragmati(sti)scher Lernprozess als Forschungsprozess
1.3 Lern- und Schulkultur
1.4 Schule und Demokratielernen als soziales Lernen
2. Der Pragmatismus als Theorie des politischen Lernens
2.1 Von der Lebenswelt zur Politik
2.2 Der Gebrauch der Dinge: Übertragung auf das politische Lernen
3. Der Pragmatismus als Theorie der Politischen Bildung
3.1 Normativität und Pragmatismus I: John Dewey
3.2 Normativität und Pragmatismus II: Charles Sanders Peirce
3.2.1 Die Pragmatische Maxime
3.2.2 Personalistische Implikationen der Pragmatischen Maxime
3.2.3 Pragmatismus und Utilitarismus
Exkurs 3: Abgrenzungen
4. Pragmatistische Normativität und Demokratielernen
4.1 Kompetenzebenen des Demokratielernens
4.2 Pragmatistische Begründungskonzepte
4.2.1 Prozessualisierung des Konflikts: das Prinzip OFFENHEIT
Exkurs 4: Pragmatistische Minimalkonsensbegründung als kriterialer Maßstab
4.2.2 Praxisreflexion als meta-kognitive Identifizierung werthaltiger Urteilskriterien
4.2.3 Transzendentalpragmatik: Die performative Begründung ethischer Minima
4.2.4 Schlussfolgerungen
TEIL III: Bausteine einer pragmatistischen Politikdidaktik
1. Sinnorientierung als pragmatistisches Prinzip
1.1 Die Suche nach Sinn als Merkmal menschlicher Praxis
1.2 Sinnentfremdungen des politischen Lernens
1.2.1 Probleme in der Inhaltsdimension
1.2.2 Probleme in der Verfahrensdimension
1.2.3 Probleme in der Ergebnisdimension
1.3 Sinnorientierung als übergreifendes politikdidaktisches Prinzip
1.3.1 Sinnorientierung als Pädagogisierung: Der Anspruch des Subjekts
1.3.2 Sinnorientierung als Re-Politisierung: Der Anspruch der Sache POLITIK
1.3.3 Sinnorientierung als Konvergenz von Lebenswelt und Politik
2. Politische Urteilsbildung als Problemlösungsprozess
2.1 Die subjektiv-biographische Eingangssituation
2.2 Rationalität und Urteilsbildung
2.2.1 Kategoriale Urteilsbildung
2.2.2 Moralische Urteilsbildung: Reflexivität und Moralität
2.2.3 Kommunikativität der Urteilsbildung
3. Offenheit von Schule
3.1 Inhaltliche Offenheit als Zusammenführung der Wissens- und Lernbereiche
3.1.1 Offenheit der Lehrpläne
3.1.2 Offenheit als partielle Entgrenzung der Fächer
3.2 Methodische Offenheit als Zusammenführung der Wissens- und Lernformen
3.2.1 Simulative Begegnung mit der politischen Außenwelt
3.2.2 Reale Begegnung mit der politischen Außenwelt
3.3 Institutionelle Offenheit von Schule als strukturelle Voraussetzung der freien Lerngemeinschaft
3.3.1 Demokratische Schulgemeinde: Der Aspekt der Schulsystemverfassung
3.3.2 Demokratische Schulgemeinde: Der Aspekt der Schulbetriebsverfassung
Exkurs 5: Musische Bildung und Sport als Politische Bildung
TEIL IV: Pragmatistische Unterrichtspraxis – Die Bausteine einer pragmatistischen Politikdidaktik im Unterricht
Fall 1: Rektorin Kohler ändert das Wahlverfahren
Fall 2: Soll die NPD verboten werden?
Fall 3: Unfair im Sportunterricht – fair in der Freizeit
Fall 4: „Was wahr ist, darf man sagen!“
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Personenregister
Sachregister
Dr. phil. Armin Scherb
lehrt als Professor für Didaktik der Sozialkunde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die Theorien der Politischen Bildung und konzeptionelle Begründungen des Demokratielernens.
"Mit Blick auf aktuelle fachdidaktische Diskussionen sei besonders hervorgehoben, dass im Entwurf der "Pragmatistischen Politikdidaktik" die Kompetenzen (...) einer äußerst soliden Theorieanbindung zugeführt werden. Des Weiteren eröffnet Scherbs Publikation hinsichtlich des Themas "Umgang mit Heterogenität" (...) gehaltvolle Perspektiven.
"Es ist zu wünschen, dass dieses Werk nicht nur in Kreisen fachdidaktischer Experten Verbreitung findet, sondern ebenso von Praktikern gelesen wird, die durch die Darlegung zur Reflexion ihrer eingeschliffenen Routinen und Unterrichtsskripte motiviert werden können."
Klaus Barheier, Forum Politikunterricht 2/14
"Zentral ist die Botschaft dieses Buches, dass mit der pragmatistischen Politikdidaktik ene Metatheorie politischer Bildung existiere, die die lebensweltbezogene, subjektorientierte und konstruktivistische Richtung auf der einen Seite mit der domänenspezifischen, fachwissenschaftlichen und instruktionsorientierten Richtung auf der anderen Seite verbinden könne."
Hans-Joachm von Olberg, POLIS 2/2015
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Politik und Bildung
Partizipation in der Demokratie basiert auf Grundlagen, die zugleich Ziel und Selbstverständnis politischer Bildung sind: Subjektorientierung, freie Urteilsbildung, Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Indoktrinationsverbot, Konflikt- und Kontroversitätsorientierung. Sie bedarf aber auch einer demokratisch gesinnten Bevölkerung, die durch ihre Partizipation Demokratie mitgestaltet, weiterentwickelt und für sie einsteht.Was bedeutet es angesichts dieser gegenseitigen Angewiesenheit für die politische Bildung, wenn sich die Formen demokratischer Herrschaft in einem rasanten Wandel befinden?Der Band beleuchtet eine Vielzahl von Entwicklungen der letzten Jahren, die einerseits unsere Demokratie verändern, andererseits aber auch neue Formen von Beteiligung hervorbringen. Herausgekommen ist eine Standortbestimmung der politischen Bildung, die den Auftrag, alle Menschen mitzunehmen und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, ernst nimmt.
Der Sammelband gibt einen Überblick zur politischen Bildung in Grundschule und Sachunterricht. Darüber hinaus werden ausgewählte Aufgaben- und Inhaltsfelder praxisnah vorgestellt.
Wie man die Leitidee nachhaltiger Entwicklung in der Berufsbildung erschließt und was politische Bildung dazu beitragen kann, stellen Expert:innen multiperspektivisch und mit praktischen Tipps in dem neuen Handbuch vor.
Angesichts des demografischen Wandels mit einem wachsenden Anteil zugewanderter Bevölkerung in Deutschland gewinnt die Beschäftigung mit dem Themenkomplex "Migration und Familie" zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund bietet das vorliegende Handbuch einen wichtigen Überblick über die bislang eher verstreuten Untersuchungen aus den verschiedenen Fachdisziplinen. Neben den sozialpädagogischen werden auch historische, rechtliche, psychologische und theologische Aspekten der Thematik behandelt. Ein besonderes Interesse gilt dabei der Frage, wie sich Migrationsprozesse auf die Bevölkerungs- und Familienstruktur sowie die Integrationspolitik auswirken. Auch stellen die Autorinnen und Autoren sozialpädagogische Handlungsfelder und deren Qualitätsanforderungen vor. Das Handbuch ist als Nachschlagewerk und Studienbuch mit grundlegenden theoretischen Artikeln zu den Themen Migration und Familie sowie zu praktischen Ansätzen und Modellen konzipiert. Dies macht eine theoriegeleitete Praxis möglich. Das Buch richtet sich u.a. an Studierende der Erziehungswissenschaft, der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Heilpädagogik und der Sozialen Arbeit; Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, Erwachsenenbildnerinnen und -bildner sowie Multiplikatoren in der Elternarbeit.
Die Transformation des Sozialstaates hat Soziale Arbeit in Europa entscheidend verändert. Die Politik des „Schirms“ soll als Mechanismus wirken, der gesellschaftliche Reichtum umverteilt werden. Zentrale Ideen eines sozialen Europas geraten dabei ins Hintertreffen. Die Beiträge zu Kernthemen Sozialer Arbeit in diesem Buch sind verbunden mit den Stichworten sozialpädagogischer Dienst, europäisches Sozialmodell, Kinderschutz, soziale Fürsorge, Institutionsentwicklung, Jugendstrategien, Gegenentwürfe zum Neo-Liberalismus und Ökonomie. Dabei wird deutlich, dass sozialstaatliche Grundlagen und Prämissen in allen europäischen Ländern prekär werden und die Arbeitsbedingungen von Sozialer Arbeit beeinflussen. Ohne eine europäische „Klagemauer“ einzurichten, werden wesentliche Aspekte der Sozialen Arbeit in den europäischen Ländern Deutschland, England, Griechenland, Litauen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn kritisch diskutiert.
Der Sammelband präsentiert Einblicke in die Erforschung von Institutionen und Praktiken der non-formalen Bildung und rückt insbesondere das Verhältnis von Bildung, Bildungsarbeit und Jugendpolitik ins Zentrum.
Eine reflexive politische Bildung zielt auf Mündigkeit ab. In diesem Buch wird eine reflexive politische Bildung in Theorie, Didaktik und Praxis skizziert, die an einer Förderung von Denk-, Handlungs- und Urteilsmöglichkeiten orientiert ist. Dafür werden didaktische Spannungsfelder in ihrer Verbundenheit mit normativen Annahmen diskutiert. Die praktische Umsetzung reflexiver Bildungserfahrungen wird im Blick auf den sozialwissenschaftlichen Unterricht sowie auf die Antisemitismusprävention in der Schule betrachtet. Im Ergebnis zeigt sich: Mündigkeit in der politischen Bildung kann nicht garantiert, aber organisiert und unterstützt werden.
Das Lehrbuch bietet – nunmehr in der dritten, vollständig überarbeiteten Auflage – einen Überblick über die Grundlagen und wichtigsten Handlungsansätze der Sozialraumorientierung. Dazu werden ihre Theorien, Methoden und konträren Positionen auf dem heutigen Stand der Diskussion dargestellt. Wer beruflich, im Rahmen seines Studiums oder der ehrenamtlichen Arbeit mit der Sozialraumorientierung befasst ist, findet in dem Band vielfältige Aspekte, die jeweils theoretisch eingeordnet und in ihrer praktischen Bedeutung erläutert werden. Zentrale Themen sind dabei die Sozialraumorientierung als Konzept Sozialer Arbeit, Raumstrukturen und ihre aktuellen Trends, quantitative und qualitative Raumanalyse, Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement, die Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen, Netzwerkorientierung, kommunale Sozialpolitik und die Arbeit im öffentlichen Raum. Ergänzt um Wiederholungsfragen und kommentierte Literaturangaben, enthält das Buch in kompakter Form die wesentlichen Informationen für alle, die an Theorie und Praxis der Sozialraumorientierung interessiert sind.
Ist unsere Demokratie angesichts andauernder politischer Krisen in Europa und der Welt sowie im Lichte des zunehmenden Populismus bereits eine „Angegriffene Demokratie“? Wir gehen davon aus, dass Demokratie nicht ohne die Integration und den Schutz von Minderheiten, nicht ohne Toleranz und nur mit einem wirksamen Bekenntnis zur universellen Gültigkeit der Menschenrechte lebendig ist und bleibt. Hierfür benötigt sie Lernen und Bildung. Das Buch widmet sich nebst perspektivischen Diagnosen zum Zustand der Demokratie der Frage, was eine „Bildung für Demokratie“ aktuell bedeuten kann.
Beratung im Kontext Rechtsextremismus unterstützt Menschen im Umgang mit extrem rechten und menschenfeindlichen Tendenzen. Der Band bietet einen Einblick in verschiedene Beratungsfelder, Methoden und Positionen dieser jungen Profession.
Ziel von Citizenship Education sind mündige Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die in der Lage sind, in bestehenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen zu agieren und darüber hinaus Herrschafts- und Machtstrukturen zu analysieren, sich ein kritisch-reflektiertes Urteil zu bilden und selbst aktiv politische Prozesse zu beeinflussen. Diskutiert wird dabei auch, wie soziale und politische Teilhabe ermöglicht und politikdidaktisch begleitet werden kann. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Fachdidaktik, der Menschenrechtsbildung und der Soziologie widmen sich Lehrkräfte und politische Bildnerinnen und Bildner aus der außerschulischen Praxis in diesem Band den (globalen) Herausforderungen gelingender Demokratiebildung. Auch Schülerinnen und Schüler kommen in einem Gastbeitrag zu Wort. Das Grundlagenbuch richtet sich an alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der Lehrkräftebildung.
Die Autorinnen und Autoren der Publikation diskutieren das Verhältnis von Emanzipation und politischen Bildungsprozessen und setzen sich aus verschiedenen Teilbereichen und Disziplinen (u.a. demokratietheoretisch, sozioökonomisch, lebensweltlich, exklusionskritisch, bildungspraktisch) mit didaktischen Konzepten um Mündigkeit und Aufklärung auseinander.Mündigkeit als Ziel politischer Bildung spiegelt sich am Begriff „Emanzipation“. Doch wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskurse in den didaktischen Strategien wider? Welche Konzepte mündiger BürgerInnenschaft werden verhandelt und welche Herausforderungen ergeben sich im Kontext von Unmündigkeit und kritischer Subjektbildung?Das Grundlagenbuch vereint Beiträge aus Wissenschaft, Hochschullehre und Unterrichtspraxis und richtet sich an Lehrkräfte, MultiplikatorenInnen und DozentInnen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der LehrerInnenbildung.
Welchen Beitrag kann Soziale Arbeit in der Schule leisten, damit Vielfalt im Sinne der unterschiedlichen Ressourcen und Potenziale von Kindern und Jugendlichen im schulischen Alltag anerkannt und gefördert wird, schulinterne Ausgrenzung vermieden und eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung für alle angestrebt wird? Dieser Frage widmet sich der vorliegende Sammelband. Alle bisher erschienenen international vergleichenden Schulleistungsstudien kommen im Hinblick auf das deutsche Bildungssystem zu dem Ergebnis, dass der Bildungserfolg stark vom sozioökonomischen Hintergrund der Kinder und Jugendlichen abhängt. Es lassen sich Selektionsmechanismen im Bildungswesen identifizieren, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht angemessen gefördert werden und Bildungskarrieren scheitern. Zugleich wird Schule durch kulturelle und soziale Heterogenität geprägt, mit der sich alle Beteiligten konfrontiert sehen. Die Auseinandersetzung mit Diversität und Disparität ist daher eine zentrale Aufgabe von Schule, die allerdings nicht allein durch die Fachkompetenz von Lehrern und Lehrerinnen zu bewältigen ist. Diese Erkenntnis hat einerseits dazu beigetragen, der Schulsozialarbeit einen gewissen Stellenwert zuzubilligen, aber andererseits noch nicht zu ihrer gesetzlichen Verankerung, soliden Finanzierung und flächendeckenden Verbreitung geführt. Zugleich sind die Aufgaben von Schulsozialarbeit zurzeit noch stark defizitorientiert und kompensatorisch definiert. In Abgrenzung davon wird hier ein ganzheitlicher, auf Ressourcen und Potenziale ausgerichteter sozialpädagogischer Ansatz und ein auf Teilhabe zielendes Bildungsverständnis vorgestellt. Wurden Themen wie Diversity und Inklusion bisher meistens allein aus Sicht der Schulpädagogik erörtert, liefert der vorliegende Band eine andere Perspektive. Hier wird die Soziale Arbeit im Kontext von Schule in den Mittelpunkt gerückt. Eine Diversity-Strategie in der Schule ermöglicht auch einen Paradigmenwechsel für Schulsozialarbeit, der in diesem Buch herausgearbeitet wird.
Welche Konsequenzen haben Diskurse zu Migration, Integration und Bildung für die Jugendarbeit? Wie können Strukturen und Angebote der Jugendarbeit im Kontext der Migrationsgesellschaft verändert und weiterentwickelt werden? Das Buch richtet sich sowohl an Forscher_innen, Studierende als auch an Praktiker_innen der Jugendarbeit und geht in kritisch-reflexiver Weise vor allem auf strukturelle Fragen der interkulturellen Öffnung ein. Vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse werden Fragen der Teilhabe und Partizipation von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aufgeworfen und Potenziale von Jugendarbeit für die Migrationsgesellschaft aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf Praxisforschungsprojekten in der verbandlichen und internationalen Jugendarbeit. Voraussetzungen und Prozesse interkultureller Öffnung werden dargestellt, Öffnungsstrategien thematisiert und künftige Aufgaben und Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis diskutiert. Leser_innen erhalten gebündelt den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung und des Diskurses zur Interkulturellen Öffnung in der Jugendarbeit als Anregung für die eigene Arbeit und als Anstoß für weitere Diskussionen.