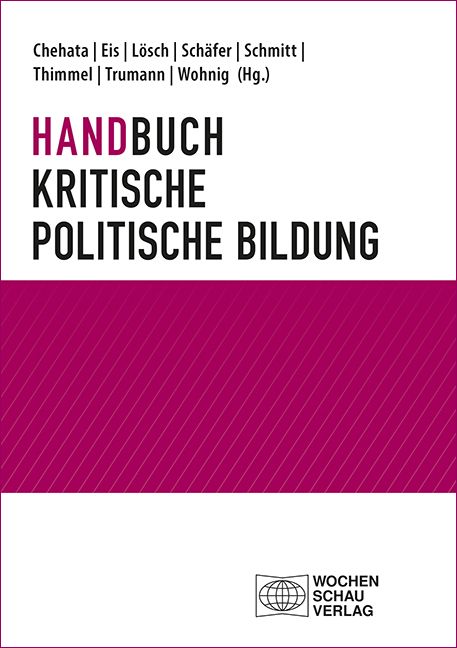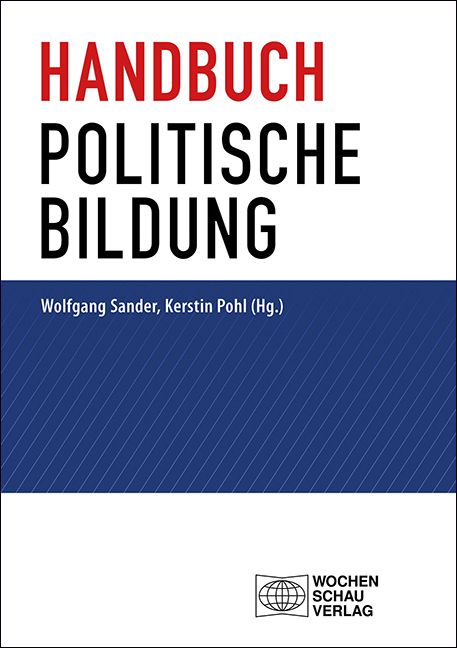Schule der Bürgergesellschaft
Bürgerschaftliche Perspektiven für moderne Bildung und gute Schulen
- herausgegeben von
- Birger Hartnuß, Reinhild Hugenroth, Thomas Kegel
- unter Mitarbeit von
- Volker Amrhein, Katharina Avemann, Lennart Beeck, Wolfgang Beutel, Josef Blank, Stefan Bestmann, Gabriele Bindel-Kögel, Michelle J. Boyd, Daniel Büchel, Wolfgang Edelstein, Kurt Edler, Adalbert Evers, Karin Fehres, Peter Friedrich, Sarah Häseler-Bestmann, Birger Hartnuß, Frank W. Heuberger, Kerstin Hübner, Klaus Hübner, Reinhild Hugenroth, Gisela Jakob, Catherina Jansen, Sybille Jester, Heike Kahl, Thomas Kegel, Ansgar Klein, Claudia Leitzmann, Richard M. Lerner, Stephan Maykus, Sigrid Meinhold-Henschel, Yvonne Möller, Siglinde Naumann, Gerd Nosek, Thomas Olk, Helmolt Rademacher, Sibylle Rahm, Thomas Rauschenbach, Ute Recknagel-Saller, Christiane Richter, Thomas Röbke, Boris Rump, Helmut Schorlemmer, Gudrun Schwind-Gick, Anne Sliwka, Vincent Steinl, Philipp Stemmer-Zorn, Bernhard Suda, Christian Weis
Der Band verfolgt das Anliegen, die Debatten um das Erlernen bürgerschaftlicher und demokratischer Kompetenzen, um Schulöffnung und Schulentwicklung sowie die Frage danach, was moderne Bildung heute ausmacht und welcher Stellenwert dabei dem bürgerschaftlichen Engagement zukommt, zusammen zu führen. Dazu werden in systematischer Form Beiträge versammelt zu: theoretischen Zugängen und Leitbildern, pädagogischen Konzepten und Reformmodellen, Methoden, Handlungsfeldern und Akteuren der Engagement- und Demokratieförderung in und mit Schulen. Das Buch bietet in dieser Gesamtschau eine Einsc…
| Bestellnummer: | 4913 |
|---|---|
| EAN: | 9783899749137 |
| ISBN: | 978-3-89974913-7 |
| Format: | Broschur |
| Reihe: | Politik und Bildung |
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
| Auflage: | 1 |
| Seitenzahl: | 432 |
- Beschreibung Der Band verfolgt das Anliegen, die Debatten um das Erlernen bürgerschaftlicher und demokratischer Kompetenzen, um Schulöffn… Mehr
- Inhaltsübersicht Birger Hartnuß, Reinhild Hugenroth, Thomas Kegel Bildungspolitik und Bürgergesellschaft: Zum Stand der Debatte 1. Theoret… Mehr
- Autor*innen Volker Amrhein, M.A., Theaterwissenschaft und Philosophie, seit 1997 Leitung des Projektebüros „Dialog der Generationen“ Pfe… Mehr
- Stimmen zum Buch "Auch wenn die Beiträge – wie in vielen Sammelbänden üblich – ein breites Spektrum an Tiefgang und Strukturierung aufweisen,… Mehr
Der Band verfolgt das Anliegen, die Debatten um das Erlernen bürgerschaftlicher und demokratischer Kompetenzen, um Schulöffnung und Schulentwicklung sowie die Frage danach, was moderne Bildung heute ausmacht und welcher Stellenwert dabei dem bürgerschaftlichen Engagement zukommt, zusammen zu führen.
Dazu werden in systematischer Form Beiträge versammelt zu:
- theoretischen Zugängen und Leitbildern,
- pädagogischen Konzepten und Reformmodellen,
- Methoden,
- Handlungsfeldern und
- Akteuren
der Engagement- und Demokratieförderung in und mit Schulen. Das Buch bietet in dieser Gesamtschau eine Einschätzung der Relevanz bürgergesellschaftlicher Reformansätze für das Schulsystem, skizziert den erreichten Entwicklungsstand und beschreibt Perspektiven und Herausforderungen in Bildungspolitik und Bürgergesellschaft.
Birger Hartnuß, Reinhild Hugenroth, Thomas Kegel
Bildungspolitik und Bürgergesellschaft: Zum Stand der Debatte
1. Theoretische Zugänge und Leitbilder
Thomas Rauschenbach
Schule und bürgerschaftliches Engagement – zwei getrennte Welten? Anmerkungen zu einer schwierigen Beziehung
Adalbert Evers Selbstständige und kooperative Schulen als soziale Unternehmen
Sybille Rahm Schulentwicklung und bürgerschaftliches Engagement
Thomas Olk Bildung durch Engagement? Zur Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für die Bildungsreform
2. Pädagogische Konzepte, Reformmodelle und Schulentwicklung: Chancen für die Bürgergesellschaft?
Wolfgang Beutel, Josef Blank, Kurt Edler, Reinhild Hugenroth, Helmolt Rademacher
Demokratiepädagogik – Chancen für eine Schule der Bürgergesellschaft?
Richard M. Lerner, Michelle J. Boyd
Engagierte Jugend – lebendige Gesellschaft. Möglichkeiten zur Stärkung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit durch positive Jugendentwicklung
Ansgar Klein Politische Bildung
Birger Hartnuß, Stephan Maykus Chancen der Partizipations- und Engagementförderung in und durch Ganztagsschulen
Claudia Leitzmann, Thomas Röbke Schulöffnung und Schulkooperationen: Brücken bauen zwischen Schule und Gemeinwesen
3. Methoden und Konzepte der Engagementförderung in und durch Schulen
Anne Sliwka
Service Learning: Lernen durch Engagement an Schulen in Deutschland
Ute Recknagel-Saller
„TOP SE“ – Engagementförderung an Realschulen in Baden-Württemberg
Thomas Kegel
Freiwilligenkoordination an Schulen – eine Möglichkeit, freiwilliges Engagement mit dem Schulalltag zu verbinden
Philipp Stemmer-Zorn
Freiwilligendienste und Schule
Stefan Bestmann, Sarah Häseler-Bestmann, Gabriele Bindel-Kögel, Daniel Büchel
Mentorenkonzepte in der Schule
Volker Amrhein
Generationendialog und Generationenlernen
Gisela Jakob
Service Learning in New York: im Übergang in eine ungewisse Zukunft
4. Engagement, Demokratie und Partizipation in Schulen
Sigrid Meinhold-Henschel
Engagement früh fördern – Netzwerke für Kinder und Jugendliche initiieren
Heike Kahl Freiwilliges Engagement und Partizipation von Kindern und Jugendlichen – Potenzial für Schule?
Lennart Beeck Schülerbeteiligung Josef Blank Der demokratiepädagogische Klassenrat
Reinhild Hugenroth Engagement, Selbstorganisation und Partizipation mit neuen Medien
5. Kooperation von Schule und Gemeinwesen: Bereiche und Akteure
Christian Weis
Jugend(verbands)arbeit und Schule
Karin Fehres, Gudrun Schwind-Gick, Boris Rump
Schule, bürgerschaftliches Engagement und Sport Kerstin Hübner Schule, bürgerschaftliches Engagement und Kultur
Klaus Hübner
Bildung für nachhaltige Entwicklung Spannendes Praxisfeld für die Kooperation zwischen Schulen und Verbänden
Yvonne Möller, Bernhard Suda
Freiwilligenzentren Gerd Nosek Möglichkeiten, Ansätze und Perspektiven schulischer Fördervereine
Christiane Richter
Seniorpartner in School e. V.
Siglinde Naumann
Interkulturelle Bildung und Interkultureller Dialog
Katharina Avemann, Catherina Jansen
„Gerne, gut und gesund in der Schule essen?“ Die Öffnung von Schulen hin zu Partizipation, Engagement und Kooperationen am Beispiel Schulverpflegung
Sybille Jester
Globales Lernen im Vor- und Grundschulalter 6. Schule und Wirtschaft
Peter Friedrich
Unternehmen und Schulen – die wissenschaftliche Entdeckung einer klassischen Kooperation
Helmut Schorlemmer
Schulsponsoring – zusätzliche Ressourcen für die Schulentwicklung
Birger Hartnuß, Frank W. Heuberger
Wirtschaft und Schule – Chancen und Grenzen einer Kooperation
7. Anstatt eines Ausblicks
Bürgerschaftliches Engagement, Demokratie und Schule: Wo stehen wir? Was ist zu tun? Wie geht’s weiter?
Ein Interview von Jens Hänisch (mdr) mit Prof. Dr. Dr. hc. Wolfgang Edelstein, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin, Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik
Volker Amrhein, M.A., Theaterwissenschaft und Philosophie, seit 1997 Leitung des Projektebüros „Dialog der Generationen“ Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH; die Serviceeinrichtung vernetzt im Auftrag des BMFSFJ bundesweit Generationen verbindende Projekte und Programme
Katharina Avemann, Dipl. Sozialwissenschaftlerin, seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen e.V., Arbeitsschwerpunkte: Schulverpflegung, Public Health, Gesundheitsförderung, Ernährungs- und Konsumsoziologie, Fat-Studies und Verbraucherpolitik
Lennart Beeck, stud.scient.pol an der Universität Kopenhagen, seit 2011 Geschäftsführender Vorstand des SV-Bildungswerks sowie Geschäftsführender Vorstand des Talented e.V., Kulturbegegnungsbotschafter in Dänemark, davor Landesschülersprecher der Gymnasien und Gesamtschulen in Schleswig-Holstein sowie Bundesdelegierter der Landesschülervertretungen Schleswig-Holsteins; Schwerpunkte: Bildung und Bildungspolitik, Beteiligungsprozesse, Entwicklungspolitik, Internationale Relationen, Konflikte des Mittleren und Nahen Ostens.
Josef Blank, seit 2007 geschäftsführender Gesellschafter von beta – Die Beteiligungsagentur in Mainz, seit 2011 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., davor u.a. Geschäftsführer des SV-Bildungswerk e.V.; Themenschwerpunkte: Demokratiepädagogik, Schulentwicklung, Individualisierung des Lernens, Bürgerbeteiligung und gesellschaftliche Teilhabe.
Stefan Bestmann, Dipl.-Päd., Dr.phil., seit 2000 selbständig in Beratung, Praxisforschung und Training [www.eins-berlin.de] zudem seit 2009 Gastprofessor für Theorien und Methoden Sozialer Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (halbes Deputat). Arbeitsschwerpunkte: Theorien und Methoden Sozialer Arbeit mit vertieftem Fokus auf Sozialraumorientierung, Gesundheitsförderung von Kinder und Jugendlichen,Bildung, Inklusion, Diversity/Vielfalt, berufsbiografische Transitionen, qualitative und quantitative sowie partizipative Forschungsmethoden
Gabriele Bindel-Kögel, Dr. phil., Dipl.-Päd., seit Anfang der 90er Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial- und Zivilrecht der TU Berlin, seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Camino Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH; Forschungsschwerpunkte: Kindschaftsrecht, Verfahrensbeistandschaft, Kinder- und Jugendkriminalität, Viktimologie, Jugend-Mentoring.
Michelle J. Boyd, Graduate Research Assistant, Eliot-Pearson Department of Child Development, Institute for Applied Research in Youth Development, Tufts University, Medford, USA
Daniel Büchel, Dipl.-Soz., Dipl.-Betriebsw. (FH), seit 2003 Freiwilligenmanager, Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH, 2009-2012 Projektleiter Mentoring-Projekt Hürdenspringer, seit 2012 Kaufmännischer Projektleiter Hürdenspringer+, Arbeitsschwerpunkte: freiwilliges und ehrenamtliches Engagement, 1:1-Jugendmentoring, Bildung, Integration, Kooperation Jugendhilfe und Schule/ Unternehmen
Adalbert Evers, Prof. Dr., Politikwissenschaftler, Professor für Sozialpolitik an der Justus-Liebig-Universität Gießen; Schwerpunkte seiner langjährigen Arbeit in Forschung, Politikberatung und Lehre betreffen Fragen des Engagements, der Demokratie und Zivilgesellschaft – speziell im Bereich sozialer Dienste; Mitglied der Sachverständigenkommission zur Erarbeitung des Zweiten Engagementberichts der Bundesregierung.
Karin Fehres, Dr. phil., seit 2006 Direktorin Sportentwicklung im DOSB, Mitglied im Sprecherrat des Bündnisses für Gemeinnützigkeit; davor u.a. im Hauptberuf Leiterin des Sportamtes Frankfurt und Generalsekretärin des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes sowie ehrenamtlich Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend, der Sportjugend Hessen und Vizepräsidentin des Deutschen Turnerbundes. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Gesellschaftliche Bedeutung des Sports und der Zivilgesellschaft.
Peter Friedrich, Dipl.-Päd., seit 2007 wiss. Mitarbeiter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg/ Philosophischen Fakultät III – Erziehungswissenschaften; Arbeitsschwerpunkte: bürgerschaftliches Engagement, Kooperation von Unternehmen und Schule, gesellschaftliches Engagement von Unternehmen.
Sarah Häseler-Bestmann, Dipl. Sozialarbeiterin, MA Erwachsenenbildnerin, freiberuflich tätig als Sozialforscherin und Beraterin, Lehrbeauftragte an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Familienzentren, Sozialraumorientierung, Gesundheitsförderung und berufsbiografische Transitionen.
Frank W. Heuberger, Dr. phil., Politische Wissenschaft, Germanistik, Philosophie; bis 2010 Leiter der "Leitstelle Bürgergesellschaft und Ehrenamt" der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz; Mitgründer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und bis 2006 Mitglied des Sprecherrats; Beauftragter des BBE für europäische Angelegenheiten; Mitgründer des Centrums für Corporate Citizenship Deutschland e.V. (CCCD); Mitglied des Board of Directors des European Network of National Civil Society Associations (ENNA). Arbeitsschwerpunkte: Analysen zum sozialen Wandel, Modelle politischer Partizipation auf kommunaler und Länder- und EU-Ebene, Corporate Citizenship und Perspektiven der Bürgergesellschaft in Europa.
Reinhild Hugenroth, Dr. phil., Sprecherin der Arbeitsgruppe „Bildung und Qualifizierung" im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, stellv. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, freiberuflich tätig, Expertisen für politische Bildung, zivilgesellschaftliches Lernen, Kompetenzerwerb im bürgerschaftlichen Engagement - mit und ohne soziale Medien.
Kerstin Hübner, M. A., Studium der Theater-, Erziehungs-, Kommunikations- und Medienwissenschaft. Bildungsreferentin bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V., Arbeitsschwerpunkte: Freiwilliges Engagement und Freiwilligendienste in der Kultur, „Kultur macht Schule“, Bündnisse für Bildung / „Kultur macht stark“
Gisela Jakob, Prof. Dr., Dipl.-Päd., seit 2004 Professur für Theorien der Sozialen an der Hochschule Darmstadt; 2000 – 2002 Mitarbeiterin in der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages. Arbeitsschwerpunkte: bürgerschaftliches Engagement, lokale Engagementförderung, Freiwilligendienste und Service-Learning in den USA.
Catherina Jansen, Ernährungswissenschaftlerin, M. Sc.; seit 2010 wiss. Mitarbeiterin und Doktorandin an der Hochschule Fulda – Zentrum für Catering, Management & Kulinaristik; Arbeitsschwerpunkte: Schulverpflegung, Schuloecotrophologie.
Sybille Jester, Juristin und Organisationsberaterin, zurzeit als integrierte Fachkraft von CIM im Bildungsministerium in Pristina, Kosovo, tätig; davor selbständige Referentin für Globales Lernen in Lübeck und zuvor Fachkraft im Bereich Demokratieförderung in Tansania und Malawi.
Thomas Kegel, Dipl.-Päd., Kommunikationswirt; seit 1999 Studienleiter der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland, Mitglied im Koordinierungsausschuss des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Arbeitsschwerpunkte: Beratung, Qualifizierung und Organisationsentwicklung zum Freiwilligenmanagement und zur Förderung des freiwilligen Engagements
Claudia Leitzmann, Studium Lehramt an Hauptschulen (1. Staatsexamen) und Germanistik (M.A.), seit 2003 Mitarbeiterin im Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, insbesondere zuständig für Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe eines vierteljährlich erscheinenden Informationsbriefs), außerdem Organisation und Moderation von Tagungen und Workshops, davor Tätigkeiten als Redakteurin und Inhaberin einer Presseagentur. Themenschwerpunkte u.a. Schule, Bildung und Bürgerschaftliches Engagement.
Richard M. Lerner, Ph.D., Bergstrom Chair in Applied Developmental Science, Director, Institute for Applied Research in Youth Development Tufts University Medford, USA
Stephan Maykus, Dr. phil. habil., seit 2008 Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule Osnabrück und seit 2012 Privatdozent für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg, davor u.a. wissenschaftlicher Angestellter und Bereichsleiter im ISA Institut für soziale Arbeit e.V. in Münster; Arbeitsschwerpunkte: Theorie, Forschung und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe, Grundlegung einer kommunalen Sozialpädagogik
Sigrid Meinhold-Henschel, Dipl.-Verwaltungswirtin, Historikerin mit Pädagogik im Nebenfach, Evaluatorin (Diplom der Universität Bern), seit 1997 für die Bertelsmann Stiftung als Projektleiterin tätig, zurzeit verantwortlich für die Initiative „jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“; Arbeitsschwerpunkte: Partizipation und Engagement, Entwicklung regionaler Bildungslandschaften, Umsetzung und Evaluation von Bildungsprojekten unter kommunalen Kontextbedingungen.
Yvonne Möller, Dipl. Sozialpädagogin, Qualitätsmanagementbeauftragte, Freiwilligenmanagerin (HKE), seit 2006 im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V., Leitung des Freiwilligen-Zentrums München Ost, Schwerpunkte der Arbeit: Vermittlung von Freiwilligen und Beratung von Einrichtungen sowie Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Bildung (Schüler engagieren sich, Schülerpatenprojekt)
Siglinde Naumann, Prof. Dr., Hochschule RheinMain, Fachbereich Sozialwesen, stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Migration und Teilhabe im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE): Arbeitsschwerpunkte: Interkulturelle Bildung, Diversityprozesse in sozialen Einrichtungen und Organisationen, Partizipation und Selbstorganisation zivilgesellschaftlicher Akteure, Lern- und Bildungsprozesse im bürgerschaftlichen Engagement.
Gerd Nosek, selbstständiger Versicherungsagent, seit 1977 Mitglied im Landesverband schulischer Fördervereine NRW e.V., seit 1999 Mitgründer des Bundesverbandes der Fördervereine in der Bundesrepublik Deutschland e.V., seit 1999 Schatzmeister beider Verbände, seit 2003 Geschäftsführer beider Verbände
Thomas Olk, Prof. Dr., seit 1991 Professor für Sozialpädagogik und Sozialpolitik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Direktoriumsmitglied des ZSB, Mitglied der COST-Action „Children’s Welfare“, Mitglied der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des 14. Deutschen Bundestages, Mitglied der unabhängigen Expertenkommission zur Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung, seit 2003 Vorsitzender des Sprecherrates des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Forschungsschwerpunkte: Kindheits- und Jugendforschung, Jugendhilfeforschung, Kooperation von Jugendhilfe und Schule, kommunale Bildungspolitik, bürgerschaftliches Engagement.
Gudrun Schwind-Gick, Dipl.-Sportwissenschaftlerin, seit 2007 Leiterin des Ressorts Bildung und Olympische Erziehung im Deutschen Olympischen Sportbund, davor Referentin im Deutschen Sportbund in unterschiedlichen Themenfeldern, u.a. Ehrenamt, Sportentwicklung, Verbandsberatung, Gesundheit, Breitensport. Arbeitsschwerpunkte: Bildungspolitik, Bildungsmanagement, Aus- und Fortbildung im organisierten Sport.
Anne Sliwka, Dr., Professorin für Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulkultur/Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Forschung und Entwicklung in den Bereichen Demokratiepädagogik, Lernen durch Engagement, Schulkultur, Lehrerprofessionalität.
Helmolt Rademacher, Lehrer, Dipl. Päd., Leiter des HKM-Projekts "Gewaltprävention und Demokratielernen" (GuD), Lehrerausbilder am Studienseminar ghrf Offenbach
Sibylle Rahm, Prof. Dr., Universitätsprofessorin für Schulpädagogik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Arbeitsschwerpunkte: Schulentwicklungsforschung, Forschung zum Lehrberuf.
Thomas Rauschenbach, Prof. Dr.; Direktor und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Jugendinstituts e.V.; Professor für Sozialpädagogik an der Universität Dortmund; Leiter des Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund und der Dortmunder Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. Bildung im Kindes- und Jugendalter, Kinder- und Jugendarbeit, soziale Berufe in Ausbildung und Arbeitsmarkt, bürgerschaftliches Engagement sowie Kinder- und Jugendhilfestatistik.
Ute Recknagel-Saller, Dipl.-Päd., seit 2012 Referentin im Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Schule und Bildung tätig mit den Schwerpunkten Realschulen und Gemeinschaftsschulen, davor u. a. als Realschulreferentin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg mit für das Themenorientierten Projekt Soziales Engagement" verantwortlich. Weitere Tätigkeiten zuvor als Schulrätin und Realschullehrerin.
Christiane Richter, Dipl.-Sozialarbeiterin, gründete 2001 den gemeinnützigen Verein Seniorpartner in School e.V., Arbeitsschwerpunkte: Bürgerschaftliches Engagement, Prävention gegen Gewalt in den Schulen und Bildungsbegleitung durch das Engagement der Seniorpartner.
Thomas Röbke, Dr., Soziologe und Sozialplaner, seit 2003 Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern, davor Gründer und Leiter des "Zentrums Aktiver Bürger" (ZAB) Nürnberg, Berater für kommunalen Infrastrukturaufbau, Autor von Beiträgen zu engagementpolitischen Fragen, Freiwilligenmanagement und Engagementförderung.
Boris Rump, Dipl.-Sportwissenschaftler, DFB A-Trainer, seit 2008 Referent für Bildung und Olympische Erziehung im Deutschen Olympischen Sportbund. Arbeitsschwerpunkte: Kooperationsfeld Sportverein und Schule sowie Ehrenamt und freiwilliges Engagement im Sport.
Helmut Schorlemmer, Oberstudiendirektor, im Schulbereich tätig seit 1974, von 1996 bis 1999 Leiter der Arbeitsgruppe "Schulsponsoring" im Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, seit 1999 Schulleiter des Pestalozzi-Gymnasiums in Unna, seit 1999 Schulsponsoringberater des Landes Nordrhein-Westfalen, seit 2012 Mitglied im Qualitätsbeirat der Deutschen Stiftung Lesen
Philipp Stemmer-Zorn, Dipl. Sozialarbeiter, seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) an der EH Freiburg, davor Abteilungsleiter Helferdienste des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Arbeitsschwerpunkte: Freiwilligendienste, Monetarisierung bürgerschaftlichen Engagements und kommunale Strategien der Engagementförderung.
Christian Weis, Dipl.-Physiker und Verwaltungs-Betriebswirt (VWA), seit 2001 Grundlagenreferent und Referent für nationale Jugendpolitik des Deutschen Bundesjugendring (DBJR), davor u.a. Geschäftsführer des Stadtjugendring Gera und stellv. Vorsitzender des Landesjugendring Thüringen.
"Auch wenn die Beiträge – wie in vielen Sammelbänden üblich – ein breites Spektrum an Tiefgang und Strukturierung aufweisen, kann dieses Werk für so manche Schulstandorte eine Vielzahl von innovativen Ideen und Beispielen bieten. Und: Es macht Hoffnung, dass die Perspektiven der aktiven Bürger/innengesellschaft bei den Jugendlichen ankommen."
Christian Fridrich, gw-unterricht.at
"Der sorgfältig redigierte Band ist ein Grundsatzwerk zum bürgerschaftlichen Engagement an Schulen, der von einem relativ positiven Bild der Schule ausgeht und stärker das Bürgerschaftliche Engagement für Schulen als von Schülerinnen und Schülern thematisiert und es bereit reflektiert."
Ansgar Drücker, Forschungsjournal: Soziale Bewegungen
"Der Sammelband zeigt souverän und deutlich, was zu tun ist und welches Verständnis von Schule der Demokratie tatsächlich umsetzbar ist. Dem Ansatz ist insofern weiterhin eine breite öffentliche und politische Resonanz zu wünschen."
Gerhard Himelmann, Politik unterrichten 1/14
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Die Gründung des „Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement“ (BBE) im Jahr 2002, auf Empfehlung des 14. Deutschen Bundestages, ist sichtbarer Ausdruck für den hohen Stellenwert der Engagementpolitik. Das Jahrbuch des BBE berichtet aus der Arbeit des Netzwerks und gibt Diskursen ein Forum, die weit in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinreichen. Zielgruppe sind die mit Engagementpolitik und Engagementförderung beruflich oder ehrenamtlich befassten Akteure in Wissenschaft, Medien, Verbänden, Stiftungen und Vereinen, Ministerien, kommunalen Fachstellen für Engagementförderung, in Freiwilligenagenturen und -zentren, Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros oder Bürgerstiftungen oder in engagementfördernden Unternehmen. Sie alle finden in dem neuen Jahrbuch ein Medium, das zur besseren Vernetzung der einzelnen Akteure und zur stärkeren Wahrnehmung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit beitragen.
Demokratisches Handeln ist die Grundlage für den Erhalt und die Erneuerung demokratischer Verhältnisse – politisch wie pädagogisch. Demokratie und Politik lernen ist deshalb ohne Handeln und ohne die Erfahrungen, die daraus erwachsen, nicht möglich: Um Demokratie zu lernen, müssen wir Demokratie erfahren! Der Band bündelt Ergebnisse und Projektbeschreibungen aus dem Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ und ist zugleich Dokumentation der Fachtagung „Begeisterung für Demokratie. 20 Jahre Demokratisch Handeln“. Dabei werden Grundlagen und Grundfragen der Demokratiepädagogik angesprochen sowie Praxisbeispiele beschrieben. Die Erträge der mit diesem Wettbewerb verbundenen Förderpraxis von Schulen und Schulentwicklung werden diskutiert und mit einer umfassenden Dokumentation des Wettbewerbes ergänzt.
Das aktuelle Jahrbuch Demokratiepädagogik behandelt zwei unterschiedliche Schwerpunktthemen: "Neue Lernkultur" und "Genderdemokratie". Zahlreiche Expertinnen und Experten beleuchten die Themen unter demokratiepädagogischen Fragestellungen. Besonders interessant sind auch diesmal wieder die Praxisberichte. Daneben finden regionale und länderübergreifende Aspekte ebenso, wie Rezensionen neuester Literatur und ein Dokumentationsteil.
Politik und Bildung
Partizipation in der Demokratie basiert auf Grundlagen, die zugleich Ziel und Selbstverständnis politischer Bildung sind: Subjektorientierung, freie Urteilsbildung, Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Indoktrinationsverbot, Konflikt- und Kontroversitätsorientierung. Sie bedarf aber auch einer demokratisch gesinnten Bevölkerung, die durch ihre Partizipation Demokratie mitgestaltet, weiterentwickelt und für sie einsteht.Was bedeutet es angesichts dieser gegenseitigen Angewiesenheit für die politische Bildung, wenn sich die Formen demokratischer Herrschaft in einem rasanten Wandel befinden?Der Band beleuchtet eine Vielzahl von Entwicklungen der letzten Jahren, die einerseits unsere Demokratie verändern, andererseits aber auch neue Formen von Beteiligung hervorbringen. Herausgekommen ist eine Standortbestimmung der politischen Bildung, die den Auftrag, alle Menschen mitzunehmen und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, ernst nimmt.
Der Sammelband gibt einen Überblick zur politischen Bildung in Grundschule und Sachunterricht. Darüber hinaus werden ausgewählte Aufgaben- und Inhaltsfelder praxisnah vorgestellt.
Wie man die Leitidee nachhaltiger Entwicklung in der Berufsbildung erschließt und was politische Bildung dazu beitragen kann, stellen Expert:innen multiperspektivisch und mit praktischen Tipps in dem neuen Handbuch vor.
Angesichts des demografischen Wandels mit einem wachsenden Anteil zugewanderter Bevölkerung in Deutschland gewinnt die Beschäftigung mit dem Themenkomplex "Migration und Familie" zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund bietet das vorliegende Handbuch einen wichtigen Überblick über die bislang eher verstreuten Untersuchungen aus den verschiedenen Fachdisziplinen. Neben den sozialpädagogischen werden auch historische, rechtliche, psychologische und theologische Aspekten der Thematik behandelt. Ein besonderes Interesse gilt dabei der Frage, wie sich Migrationsprozesse auf die Bevölkerungs- und Familienstruktur sowie die Integrationspolitik auswirken. Auch stellen die Autorinnen und Autoren sozialpädagogische Handlungsfelder und deren Qualitätsanforderungen vor. Das Handbuch ist als Nachschlagewerk und Studienbuch mit grundlegenden theoretischen Artikeln zu den Themen Migration und Familie sowie zu praktischen Ansätzen und Modellen konzipiert. Dies macht eine theoriegeleitete Praxis möglich. Das Buch richtet sich u.a. an Studierende der Erziehungswissenschaft, der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Heilpädagogik und der Sozialen Arbeit; Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, Erwachsenenbildnerinnen und -bildner sowie Multiplikatoren in der Elternarbeit.
Die Transformation des Sozialstaates hat Soziale Arbeit in Europa entscheidend verändert. Die Politik des „Schirms“ soll als Mechanismus wirken, der gesellschaftliche Reichtum umverteilt werden. Zentrale Ideen eines sozialen Europas geraten dabei ins Hintertreffen. Die Beiträge zu Kernthemen Sozialer Arbeit in diesem Buch sind verbunden mit den Stichworten sozialpädagogischer Dienst, europäisches Sozialmodell, Kinderschutz, soziale Fürsorge, Institutionsentwicklung, Jugendstrategien, Gegenentwürfe zum Neo-Liberalismus und Ökonomie. Dabei wird deutlich, dass sozialstaatliche Grundlagen und Prämissen in allen europäischen Ländern prekär werden und die Arbeitsbedingungen von Sozialer Arbeit beeinflussen. Ohne eine europäische „Klagemauer“ einzurichten, werden wesentliche Aspekte der Sozialen Arbeit in den europäischen Ländern Deutschland, England, Griechenland, Litauen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn kritisch diskutiert.
Der Sammelband präsentiert Einblicke in die Erforschung von Institutionen und Praktiken der non-formalen Bildung und rückt insbesondere das Verhältnis von Bildung, Bildungsarbeit und Jugendpolitik ins Zentrum.
Eine reflexive politische Bildung zielt auf Mündigkeit ab. In diesem Buch wird eine reflexive politische Bildung in Theorie, Didaktik und Praxis skizziert, die an einer Förderung von Denk-, Handlungs- und Urteilsmöglichkeiten orientiert ist. Dafür werden didaktische Spannungsfelder in ihrer Verbundenheit mit normativen Annahmen diskutiert. Die praktische Umsetzung reflexiver Bildungserfahrungen wird im Blick auf den sozialwissenschaftlichen Unterricht sowie auf die Antisemitismusprävention in der Schule betrachtet. Im Ergebnis zeigt sich: Mündigkeit in der politischen Bildung kann nicht garantiert, aber organisiert und unterstützt werden.
Das Lehrbuch bietet – nunmehr in der dritten, vollständig überarbeiteten Auflage – einen Überblick über die Grundlagen und wichtigsten Handlungsansätze der Sozialraumorientierung. Dazu werden ihre Theorien, Methoden und konträren Positionen auf dem heutigen Stand der Diskussion dargestellt. Wer beruflich, im Rahmen seines Studiums oder der ehrenamtlichen Arbeit mit der Sozialraumorientierung befasst ist, findet in dem Band vielfältige Aspekte, die jeweils theoretisch eingeordnet und in ihrer praktischen Bedeutung erläutert werden. Zentrale Themen sind dabei die Sozialraumorientierung als Konzept Sozialer Arbeit, Raumstrukturen und ihre aktuellen Trends, quantitative und qualitative Raumanalyse, Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement, die Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen, Netzwerkorientierung, kommunale Sozialpolitik und die Arbeit im öffentlichen Raum. Ergänzt um Wiederholungsfragen und kommentierte Literaturangaben, enthält das Buch in kompakter Form die wesentlichen Informationen für alle, die an Theorie und Praxis der Sozialraumorientierung interessiert sind.
Ist unsere Demokratie angesichts andauernder politischer Krisen in Europa und der Welt sowie im Lichte des zunehmenden Populismus bereits eine „Angegriffene Demokratie“? Wir gehen davon aus, dass Demokratie nicht ohne die Integration und den Schutz von Minderheiten, nicht ohne Toleranz und nur mit einem wirksamen Bekenntnis zur universellen Gültigkeit der Menschenrechte lebendig ist und bleibt. Hierfür benötigt sie Lernen und Bildung. Das Buch widmet sich nebst perspektivischen Diagnosen zum Zustand der Demokratie der Frage, was eine „Bildung für Demokratie“ aktuell bedeuten kann.
Beratung im Kontext Rechtsextremismus unterstützt Menschen im Umgang mit extrem rechten und menschenfeindlichen Tendenzen. Der Band bietet einen Einblick in verschiedene Beratungsfelder, Methoden und Positionen dieser jungen Profession.
Ziel von Citizenship Education sind mündige Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die in der Lage sind, in bestehenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen zu agieren und darüber hinaus Herrschafts- und Machtstrukturen zu analysieren, sich ein kritisch-reflektiertes Urteil zu bilden und selbst aktiv politische Prozesse zu beeinflussen. Diskutiert wird dabei auch, wie soziale und politische Teilhabe ermöglicht und politikdidaktisch begleitet werden kann. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Fachdidaktik, der Menschenrechtsbildung und der Soziologie widmen sich Lehrkräfte und politische Bildnerinnen und Bildner aus der außerschulischen Praxis in diesem Band den (globalen) Herausforderungen gelingender Demokratiebildung. Auch Schülerinnen und Schüler kommen in einem Gastbeitrag zu Wort. Das Grundlagenbuch richtet sich an alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der Lehrkräftebildung.
Die Autorinnen und Autoren der Publikation diskutieren das Verhältnis von Emanzipation und politischen Bildungsprozessen und setzen sich aus verschiedenen Teilbereichen und Disziplinen (u.a. demokratietheoretisch, sozioökonomisch, lebensweltlich, exklusionskritisch, bildungspraktisch) mit didaktischen Konzepten um Mündigkeit und Aufklärung auseinander.Mündigkeit als Ziel politischer Bildung spiegelt sich am Begriff „Emanzipation“. Doch wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskurse in den didaktischen Strategien wider? Welche Konzepte mündiger BürgerInnenschaft werden verhandelt und welche Herausforderungen ergeben sich im Kontext von Unmündigkeit und kritischer Subjektbildung?Das Grundlagenbuch vereint Beiträge aus Wissenschaft, Hochschullehre und Unterrichtspraxis und richtet sich an Lehrkräfte, MultiplikatorenInnen und DozentInnen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der LehrerInnenbildung.
Welchen Beitrag kann Soziale Arbeit in der Schule leisten, damit Vielfalt im Sinne der unterschiedlichen Ressourcen und Potenziale von Kindern und Jugendlichen im schulischen Alltag anerkannt und gefördert wird, schulinterne Ausgrenzung vermieden und eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung für alle angestrebt wird? Dieser Frage widmet sich der vorliegende Sammelband. Alle bisher erschienenen international vergleichenden Schulleistungsstudien kommen im Hinblick auf das deutsche Bildungssystem zu dem Ergebnis, dass der Bildungserfolg stark vom sozioökonomischen Hintergrund der Kinder und Jugendlichen abhängt. Es lassen sich Selektionsmechanismen im Bildungswesen identifizieren, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht angemessen gefördert werden und Bildungskarrieren scheitern. Zugleich wird Schule durch kulturelle und soziale Heterogenität geprägt, mit der sich alle Beteiligten konfrontiert sehen. Die Auseinandersetzung mit Diversität und Disparität ist daher eine zentrale Aufgabe von Schule, die allerdings nicht allein durch die Fachkompetenz von Lehrern und Lehrerinnen zu bewältigen ist. Diese Erkenntnis hat einerseits dazu beigetragen, der Schulsozialarbeit einen gewissen Stellenwert zuzubilligen, aber andererseits noch nicht zu ihrer gesetzlichen Verankerung, soliden Finanzierung und flächendeckenden Verbreitung geführt. Zugleich sind die Aufgaben von Schulsozialarbeit zurzeit noch stark defizitorientiert und kompensatorisch definiert. In Abgrenzung davon wird hier ein ganzheitlicher, auf Ressourcen und Potenziale ausgerichteter sozialpädagogischer Ansatz und ein auf Teilhabe zielendes Bildungsverständnis vorgestellt. Wurden Themen wie Diversity und Inklusion bisher meistens allein aus Sicht der Schulpädagogik erörtert, liefert der vorliegende Band eine andere Perspektive. Hier wird die Soziale Arbeit im Kontext von Schule in den Mittelpunkt gerückt. Eine Diversity-Strategie in der Schule ermöglicht auch einen Paradigmenwechsel für Schulsozialarbeit, der in diesem Buch herausgearbeitet wird.
Welche Konsequenzen haben Diskurse zu Migration, Integration und Bildung für die Jugendarbeit? Wie können Strukturen und Angebote der Jugendarbeit im Kontext der Migrationsgesellschaft verändert und weiterentwickelt werden? Das Buch richtet sich sowohl an Forscher_innen, Studierende als auch an Praktiker_innen der Jugendarbeit und geht in kritisch-reflexiver Weise vor allem auf strukturelle Fragen der interkulturellen Öffnung ein. Vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse werden Fragen der Teilhabe und Partizipation von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aufgeworfen und Potenziale von Jugendarbeit für die Migrationsgesellschaft aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf Praxisforschungsprojekten in der verbandlichen und internationalen Jugendarbeit. Voraussetzungen und Prozesse interkultureller Öffnung werden dargestellt, Öffnungsstrategien thematisiert und künftige Aufgaben und Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis diskutiert. Leser_innen erhalten gebündelt den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung und des Diskurses zur Interkulturellen Öffnung in der Jugendarbeit als Anregung für die eigene Arbeit und als Anstoß für weitere Diskussionen.