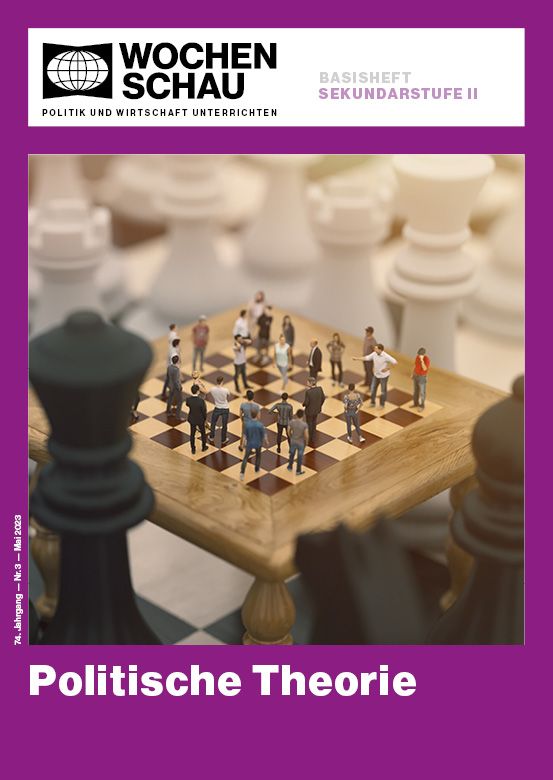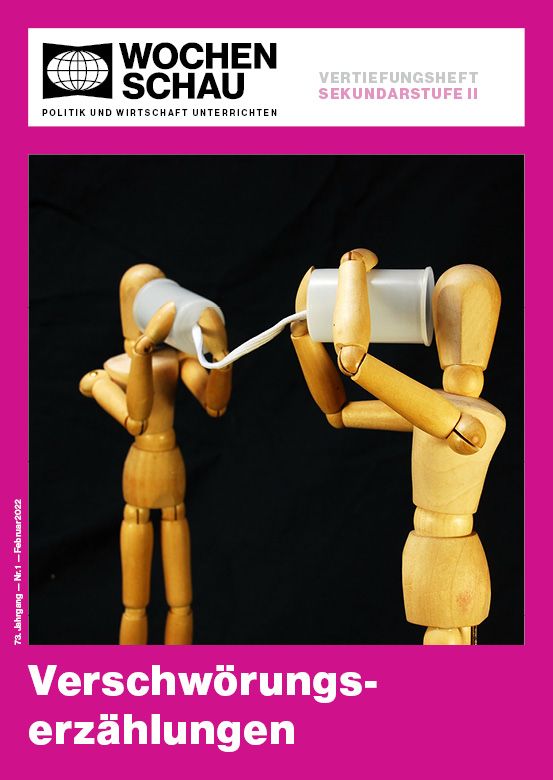Zu "Wochenschau, Sek. II" wurden 38 Titel gefunden
Mit diesem Vertiefungsheft werden Schüler*innen der Sekundarstufe II bei der Auseinandersetzung mit Antisemitismus angeleitet. Sie befassen sich mit historischen und aktuellen Erscheinungsformen des Phänomens und lernen, antisemitische Stereotype, Narrative und Symboliken zu entziffern. Eine kritische Beschäftigung mit Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft heute steht dabei im Vordergrund. Darüber hinaus unterstützt das Heft beim Erwerb von Urteils- und Handlungskompetenzen in Bezug auf judenfeindliche Diskriminierung. Anhand konkreter Fallbeispiele werden antisemitische Vorfälle und Argumentationen kritisch eingeordnet und Handlungsoptionen im Umgang mit Antisemitismus erarbeitet.
Dieses WOCHENSCHAU-Basisheft für die Sekundarstufe II beleuchtet einen scheinbar unlösbaren Konflikt. Die Schüler*innen erforschen die Zielkonflikte, die sich hinter den beiden großen Begriffen verbergen. Handlungsorientiert und praxisnah werden die Schüler*innen mit den bestehenden politischen Kontroversen konfrontiert und lernen, sich begründet zu positionieren. Gibt es Grenzen des Wachstums? Das Problembewusstsein der Schüler*innen wird gestärkt, während ihnen auch alternative Konzepte der jetzigen Wirtschaftsweise vorgestellt werden und die Haushaltsdebatte, die sich in diesem Zielkonflikt befindet, aufarbeiten.
Die Bundestagswahl 2025 wird für die zukünftige Ausgestaltung unserer Demokratie entscheidend. Sie wird unter den Eindrücken der Europawahl und den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen stattfinden und es wird sich zeigen, inwieweit sich die autoritären Tendenzen in der Bundesrepublik festsetzen. Dieses Heft beschäftigt sich mit der Funktion und Bedeutung von Wahlen und Parteien für die Demokratie in der Bundesrepublik. Dabei lernen die Schüler*innen den Ablauf der Bundestagswahl kennen, setzen sich kritisch mit dem deutschen Wahlsystem auseinander und reflektieren die Rolle von Parteien. Schließlich werden die Schüler*innen in die Grundlagen der Wahlsoziologie und in Theorien des Wahlverhaltens eingeführt.
„Meiner Ansicht nach ist es sehr, sehr früh, um loszugehen und einen Sarg für die Globalisierung zu kaufen.“ (Kristalina Georgiewa, Chefin des Internationalen Währungsfonds) Politische Figuren wie Donald Trump haben mit ihren protektionistischen Handelspolitiken der Globalisierung den Krieg angesagt, aber ist die Globalisierung damit am Ende? Schüler*innen der Sekundarstufe II erkunden in diesem Basisheft fall- und problemorientiert globale Kontroversen, die die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen betreffen. Die Frage, ob Globalisierung sozialverträglich und gerecht gestaltet werden kann, nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Nach der Bearbeitung dieser WOCHENSCHAU können sich die Schüler*innen ein fundiertes Urteil zu Fragen der globalen Wirtschaftsbeziehungen bilden.
Dieses Vertiefungsheft für die Sekundarstufe II ergänzt das Heft „Das politische System der BRD“ um die Prozess-Dimension. In politischen Entscheidungsprozessen geht es um die Bewältigung von Problemen. Der Entscheidung geht eine Auseinandersetzung voraus, an der in der Demokratie verschiedene Akteur*innen beteiligt sind. Sie stehen in diesem Heft im Fokus. Schüler*innen lernen anhand aktueller Fallbeispiele, wie in der Bundesrepublik Deutschland politische Entscheidungen zustande kommen und welche Rolle dabei etwa Parteien, zivilgesellschaftliche Gruppen oder Expert*innen spielen.
Mit dem WOCHENSCHAU-Heft „Rechtspopulismus“ erarbeiten sich Schüler*innen der Sekundarstufe II, was rechtspopulistische Politik ausmacht und warum diese für Parteien attraktiv erscheint. Zunächst wird geklärt, was Rechtspopulismus ist, er wird von Rechtsextremismus abgegrenzt und es werden rechtspopulistische Strategien von rechtspopulistischer Ideologie unterschieden. Anschließend wird die CDU als Fallbeispiel einer konservativen Partei untersucht, die sich durch die AfD von rechts unter Druck gesetzt sieht und die daraus folgenden Strategien werden analysiert.
Alle sind sich einige, dass die ökologische Transformation der Gesellschaft, Wirtschaft und der Staatengemeinschaft notwendig ist, doch wie kann sie auch sozialverträglich gelingen? Dieser Umstand soll im Themenheft „Sozialökologische Transformation“ für die Sekundarstufe II des Politik- und Gesellschaftsunterrichts betrachtet und kritisch beurteilt werden.Das Heft behandelt die Rolle der Regierung, Zivilgesellschaft und Individuen, Widersprüche in der Energiepolitik sowie internationale Abkommen. Anhand exemplarischer Fälle in Schlüsselindustrien wie Automobil-, Energie- sowie Lebensmittelbranche sollen Schüler*innen kompetenzorientiert an politische Entscheidungen, Chancen und Probleme herangeführt werden. Ihre Wissenschafts-, Urteils- und Handlungskompetenz wird im Rahmen unseres neuesten Basisheftes geschult und erweitert.
Was ist soziale (Un-)Gleichheit und wie unterscheidet sie sich von sozialer (Un-)gerechtigkeit? Schüler*innen der Sekundarstufe II setzen sich im Themenheft "Soziale (Un-)Gleichheit" unter anderem mit dieser Frage auseinander und lernen in dem Zusammenhang Messinstrumente der Ungleichheitsforschung kennen. Sie erfahren, wie es um die soziale (Un-)Gleichheit in Deutschland steht und beleuchten im Zuge dessen den deutschen Sozialstaat. Dabei ermöglichen aktuelle Debatten aus dem deutschen Kontext (z. B. Kinderarmut, Vermögensumverteilung, bedingungsloses Grundeinkommen) einen umfassenden Einblick in die Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsdiskurse der Gegenwart. Mit diesem lebensweltorientierten Heft schulen Lernende im Rahmen des Politik- und Gesellschaftsunterrichts ihre Analyse-, Urteils- und Handlungskompetenz.
Das Basisheft für die Sekundarstufe II gibt einen umfassenden Einblick in Institutionen, Kompetenzen und politische Prozesse der Europäischen Union. Das Themenheft beginnt mit einer Einordnung der Einstellungen gegenüber der EU, die in den letzten zwei Jahrzehnten stark schwankten. Einem problemorientierten Einblick in die Geschichte des europäischen Integrationsprozesses folgt eine vertiefende Behandlung des politischen Prozesses im Mehrebenensystem der EU sowie eine Analyse aktueller Herausforderungen wie Korruption, Krieg in Europa und Nationalisierungstendenzen in einzelnen EU-Staaten. Abschließend wird das Regierungssystem der EU mit ihren möglichen demokratischen Defiziten kritisch beleuchtet.
Freiheit ist ein schillernder Begriff unserer demokratischen Ideengeschichte. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde der Begriff unter der Frage diskutiert, ob Eingriffe in unsere Freiheitsrechte legitim sind. Aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine scheint sich das Spannungsverhältnis Freiheit vs. Sicherheit neu zu öffnen. Dieses WOCHENSCHAU-Vertiefungsheft nimmt die aktuellen Kontoversen rund um den Freiheitsbegriff auf und verbindet sie mit Gerechtigkeitsfragen in Bezug auf Gleichheit. Es werden zwei Grundbegriffe der modernen Demokratie problemorientiert und fallbezogen diskutiert, beispielsweise anhand der Regulierung von sozialen Medien oder der Verteilung von Armut und Wohlstand auf der Welt.
Statt einer musealen Aufbereitung klassischer Texte bietet das Basisheft „Politische Theorie“ vielfältige problemorientierte Zugänge zur Ideengeschichte und lädt Schüler*innen der Sekundarstufe II ein, politische Grundfragen in ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung zu erörtern. Um ein exemplarisches Lernen zu ermöglichen, werden immer wieder alltagsnahe Fälle und Beispiele zur Verdeutlichung der politischen Theorien herangezogen. Dies soll einen Raum eröffnen, in dem Schüler*innen ihre Fragen und Deutungen des politischen Zusammenlebens artikulieren und selbst Bezüge zwischen politiktheoretischen Einsichten und ihrem Alltag herstellen können. Innerhalb des Basisheftes werden Fragestellungen zur Staatstheorie (Hobbes, Locke, Rousseau), zum Regierungsmodell (Alexis de Tocqueville u. a.), der Legitimierung der Menschenwürde (Kant, Bentham, Arendt u. a.) und zu Gerechtigkeit in Bildungsfragen (Rawls u. a.) bearbeitet.
Mit den Landtagswahlen 2023 vor der Tür richtet sich das WOCHENSCHAU-Zusatzheft„Landtagswahlen Hessen“ an Schüler*innen, insbesondere im wahlfähigen Alter. Hier erfahren Schüler*innen der Sekundarstufe II, wie sie zu einer Wahlentscheidung kommen können, warum Länder Parlamente haben und wie eine Wahl eigentlich abläuft. Sie finden eine Anleitung zur Wahl im Wahllokal oder per Brief, lesen ein Interview zum Wahl-O-Mat und beschäftigen sich zum Schluss kritisch mit den demokratischen Eigenschaften einer Wahl. Das Themenheft „Landtagswahl Hessen“ ist mehr als ein Informationsflyer. Es enthält ein Arbeitsblatt zu „Was darf der Landtag eigentlich entscheiden?“, aber auch Material zur kritischen Prüfung, wer überhaupt an Landtagswahlen teilnehmen darf. So können Schüler*innen ihr eigenes Wissen zu diesen Themen prüfen und angeleitet vom Material die Teilhabemöglichkeiten in Ihrem Bundesland hinterfragen. Praktische Informationen zum Ablauf eines Gangs zur Urne oder der Briefwahl sollen den Erstwähler*innen die Angst vor „Fehlern“ nehmen und die Bereitschaft zur Teilnahme an der Wahl erhöhen. Zum Schluss können Schüler*innen auch Koalitionsverhandlungen simulieren und dabei herausfinden, wie Verhandlungsprozesse in der Politik funktionieren und welche Herausforderungen mit diesen verbunden sind.
"Die Ideen der Nationalökonomen und politischen Philosophen, gleich ob sie nun wahr oder falsch sein mögen, sind von weit größerem Einfluss, als man gemeinhin annimmt. In Wirklichkeit wird die Welt von nichts anderem regiert”, so formulierte es John Maynard Keynes. In diesem Vertiefungsheft sind Schüler*innen der Sekundarstufe II eingeladen, sich mit klassischen, wie neueren ökonomischen Theorien und Kontroversen, sowie deren Weltwirksamkeit auseinanderzusetzen: von der grundlegenden Frage, wie Menschen Entscheidungen treffen und was sie antreibt (homo oeconomicus vs. homo culturalis), über eine Bandbreite ökonomischer Theorien im Hinblick auf Wohlstand und Verteilung (Smith, Marx, Hayek, Ostrom, Gottschlich), aktuellen Entwicklungen wie der feministischen Ökonomie, bis hin zu den idealtypischen Gegenpositionen in der Wirtschaftspolitik: dem angebotsorientierten und dem nachfrageorientierten Ansatz (Friedman vs. Keynes).
Mit der WOCHENSCHAU „Migrationsgesellschaft“ vertiefen Schüler*innen der Sekundarstufe II die unterschiedlichen Facetten unserer durch Migration geprägten Gesellschaft. Das Themenheft beleuchtet Erfahrungen migrantisch-gelesener Gruppen im Alltag und wie gesellschaftliche Teilhabe stattfindet. Im Eingangskapitel geht es zunächst um die Migration als festen Bestandteil unserer Gesellschaft und Politik, anschließend setzen sich die Schüler*innen kritisch mit denen Einwanderungsplänen der wichtigsten deutschen Parteien auseinander. Zum Schluss lernen die Schüler*innen anhand des Beispiels der Bildungsinitiative Ferhat Unvar Erfolge und Herausforderungen bei der aktiven Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in Politik und Zivilgesellschaft kennen.
Was ist Sicherheitspolitik? Wie hat sie sich entwickelt? Welche Institutionen sind wichtig? Welche Haltung nehmen die verschiedenen Parteien ein? Diese und weitere Fragen werden im WOCHENSCHAU-Heft „Sicherheitspolitik in einer prekären Weltordnung“ behandelt. Dafür analysieren die Schüler*innen verschiedene Fallbeispiele hinsichtlich der zutage tretenden Sicherheitsverständnisse und beteiligten Akteure. Ziel ist eine Vorstellung davon zu entwickeln, wer die Welt wie ordnet bzw. ordnen will.
Das aktualisierte Vertiefungsheft nimmt die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Themen in der Europäischen Union in den Blick: Vor dem Hintergrund einer Szenario-Analyse werden die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Brexit betrachtet. Im zweiten Kapitel steht das Thema Migrationsbewegungen im Fokus. Nach der Darstellung des rechtlichen Rahmens folgt eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Diskussion zu dem Thema in der EU, anhand derer die Schüler*innen die Folgen, die Verteilungsproblematik sowie die Frage nach der Handlungsfähigkeit der EU bearbeiten können. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU wird schließlich im dritten Kapitel angeregt, bevor es im letzten Kapitel um die Frage nach der Energie- und Klimapolitik der EU und den damit verbundenen ökonomischen und sozialen Folgen geht.
Das WOCHENSCHAU Basisheft „Das politische System der BRD“ gibt einen Einblick in Strukturen, Prozesse und Akteure der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Die Schüler*innen lernen unter anderem Prozesse der Gesetzgebung kennen, können grundlegende Prinzipien wie das Rechtsstaatsprinzip einordnen und setzen sich mit dem Grundgesetz auseinander. Dabei steht alles unter der Fragestellung „Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf das politische System?“. Außerdem wird die Bundestagswahl 2021 analysiert.
Mit dieser WOCHENSCHAU-Ausgabe blicken Sie mit Ihren Schüler*innen über die Erzählungen der (neo)klassischen Ökonomie hinaus und lernen verschiedene Perspektiven auf alternative Wirtschaftsformen kennen. Ein handlungsorientierter und diskursvier Einstieg ermöglicht einen schüler*innennahen Unterricht. Im weiteren Verlauf des Themenheftes können die Schüler*innen ihre Meinungsbildung anhand diverser Konzepte kontrovers diskutieren.
Mit diesem WOCHENSCHAU-Themenheft setzen sich die Schüler*innen der Sekundarstufe II mit den aktuellen Diskursentwicklungen auseinander und lernen die Narrative und Erzählstrategien von Mythenbildungen kennen und einschätzen. Die Schüler*innen werden in die Lage versetzt, sich argumentativ und kritisch den Verführungen einfacher und demokratiegefährdender Erzählungen entgegenzustellen. Dabei steht das exemplarische, kontroverse und wissenschaftliche Arbeiten stets im Vordergrund und befähigt die Schüler*innen in ihrer konstruktiven Meinungsbildung innerhalb des demokratischen Spektrums.
Die WOCHENSCHAU „Politik postkolonial“ unterstützt Lerngruppen darin, hegemoniales Wissen aus post- und dekolonialer Sicht hinterfragen zu lernen. Zu Beginn werden anhand alltäglicher Beispiele die koloniale Vergangenheit Deutschlands und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart aufgezeigt, und auch die Kontroversen bzgl. des richtigen Umgangs hiermit in den Unterricht geholt. In einem nächsten Schritt setzen sich die Schüler*innen mit dem Verständnis von Wissen und Wissenschaft auseinander, das sowohl damaliger als auch heutiger Politik und anhaltenden rassistischen Strukturen zugrunde liegt: der eurozentrischen, dualistischen Sicht der Moderne. Diese Distanzierung vom eigenen Paradigma wird durch die Kontrastierung mit ausgewählten post- und dekolonialen Ansätzen erleichtert. Abschließend wenden die Schüler*innen diese Ansätze auf politische Konflikte sowie ihren eigenen Nahbereich an: die Institution Schule und die Praxis internationaler Freiwilligendienste.
Wie hängen Subjekt und Gesellschaft zusammen, wie zeigt sich soziale Ungleichheit und Protest auch auf Ebene der Globalgesellschaft, und in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Mit dieser WOCHENSCHAU setzen sich Schüler*innen von Mikro- bis Makroebene mit der so abstrakten „Gesellschaft“ auseinander. Dabei begegnen sie grundlegenden Theorieansätzen ebenso wie aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen u.a. im Hinblick auf Race, Class und Gender. Abschließend stellen sie sich Angriffen auf die offene Gesellschaft – Fake News, Rechtsruck, Verschwörungsideologien – um vor dieser Negativfolie eigene Utopien zu entwickeln.
Im Herbst 2020 hat die EU ihren ersten Rechtsstaatlichkeitsbericht vorgelegt und spricht Deutschland darin ein insgesamt gutes Urteil aus: Kritisiert wird das Weisungsrecht, dass die Justizminister*innen über Staatsanwält*innen haben. Aber die Unabhängigkeit der Richter*innen, Effizienz, Personalstärke und auch Digitalisierung seien positiv zu bewerten. Die WOCHENSCHAU Justiz kontrovers zieht weitere Analysen, Lageberichte und exemplarische Fallbeispiele heran und vertieft neben Grundlagenwissen auch obige Themen. Welche Rolle spielen Gerichte während der Corona-Pandemie und wie zeigt sich hier das Prinzip der Rechtsgüterabwägung? Wie kann die Qualität der Rechtsprechung bestehen bleiben, wenn Justizbehörden als Arbeitsplatz an Attraktivität verlieren? Wie sieht das Vertrauensverhältnis der Bürger*innen, insbesondere von Minderheiten, in die Justiz aus und welche Konsequenzen kann dies haben? Ist die Justiz auf dem rechten Auge blind? Die WOCHENSCHAU Justiz kontrovers richtet sich, gewohnt differenziert, problemorientiert und aktuell an Schüler*innen der Sekundarstufe II.
Dieses Vertiefungsheft beschäftigt sich mit der Funktion und Bedeutung von Wahlen und Parteien für die Demokratie in der Bundesrepublik. Dabei lernen die Schüler*innen den Ablauf der Bundestagswahl kennen, setzen sich kritisch mit dem deutschen Wahlsystem auseinander und reflektieren die Rolle von Parteien. Schließlich werden die Schüler*innen in die Grundlagen der Wahlsoziologie und in Theorien des Wahlverhaltens eingeführt.
Das aktualisierte Basisheft für die Sekundarstufe II geht im Einstiegskapitel der Frage nach, warum wirtschaftlich gehandelt wird. Anhand von Fallbeispielen aus der Alltagswelt von Schüler*innen wird über Kriterien der Entscheidungsfindung und die eigene Rolle im Wirtschaftssystem reflektiert. Schwerpunkt dieses Kapitels ist das Kennenlernen relevanter Akteure und der Umgang mit Modellen wie etwa dem Wirtschaftskreislauf. Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die Ziele der Wirtschaftspolitik in Deutschland und der EU. Dabei werden Wirtschaftsordnungen vergleichend sowie die Wettbewerbspolitik betrachtet. Methodischer Schwerpunkt dieses Kapitels sind die Analyse von Karikaturen und der Umgang mit statistischen Daten. Die Instrumente der Wirtschaftspolitik, verbunden mit der Frage, wie die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst bzw. gesteuert werden kann, sind die Themen des dritten Kapitels, das sich mit Konjunkturzyklen und -theorien beschäftigt und eine Kursarbeit zur Übung umfasst.