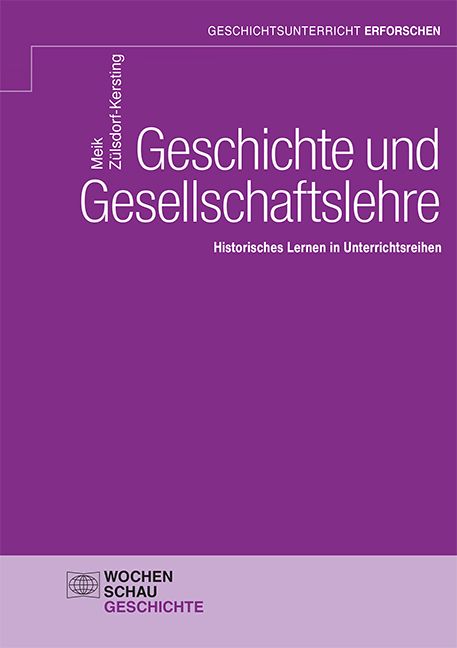- Programm
- Zeitschriften
- Schule
- Wissenschaft
- Open Access
- elibrary
- Reihen
- Autor*innen
- Kontakt
Der Band „Geschichte lernen digital“ widmet sich dem historischen Lernen in der digital geprägten Lernumgebung segu. In einer Angebot-Nutzungs-Studie analysiert Lena Liebern zum einen das Lernangebot der Plattform. Zum anderen wertet sie den Umgang von Schüler*innen mit digitalen Medien aus. Dabei steht die (non)verbale Kommunikation über verschiedene Aufgabenformate im Fokus, um Praktiken historischen Denkens zu rekonstruieren. Die Autorin stellt heraus, dass digital geprägte Lernumgebungen den Geschichtsunterricht nicht radikal verändern, sondern eine Veränderung der kulturellen Praktiken im Umgang mit Quellen und Darstellungen hervorgerufen haben.
Michael Sauer ist einer der bekanntesten Geschichtsdidaktiker Deutschlands, der zu vielen Aspekten der Disziplin publiziert hat. In dieser Festschrift greifen Kolleginnen und Kollegen Sauers Impulse auf und setzen sich damit auseinander.
Die Autor*innen dieses Bandes nehmen Genderfragen in den Blick. Die Beiträge verdeutlichen das breite Feld der Auseinandersetzung mit queer-feministischen und heteronormativitätskritischen Perspektiven in der politikdidaktischen Forschung und zeigen, warum eine Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Gender die Politikdidaktik stärkt. Die Autor*innen öffnen theoretische Diskurse, binden aber auch queer-feministische und heteronormativitätskritische Anliegen in einem intersektionalen Verständnis stärker in die bestehende politikdidaktische Arbeit ein.Zur Reihe:Die neue Reihe Gender in politischer Bildungs- und Transferforschung schafft ein Forum für Diskussion um Gender und Intersektionalität in der politischen Bildungsforschung unter besonderer Berücksichtigung einer transferorientierten Perspektive. Sie bietet einem interdisziplinären Publikum direkten Zugang zu empirischen und theoretischen Fortschritten und stärkt die Verflechtungen mit anderen Disziplinien, um Gender als Querschnittsthema der Bildungsforschung zu etablieren.
Soll sich der Staat überhaupt in die Ernährung der Bürger*innen einmischen? Wenn nicht: Wer oder was bestimmt dann, was zu welchen Herstellungsbedingungen und mit welchen gesundheitlichen Konsequenzen auf unseren Tellern landet?
Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und Transformation steht das historische Lernen vor vielfältigen Herausforderungen und Neuorientierungen. Mit den Themenfeldern Digitalität, Sprache und Geschichtskultur werden einige relevante Themengebiete für zeitgemäßes historisches Lernen im 21. Jahrhundert beleuchtet.
Die methodenorientierte Politikdidaktik bietet für die Unterrichtsplanung ein schlüssiges und zügiges Vorgehen. Für die Inhaltsbereiche politisch empörende Ereignisse, Schlüsselprobleme der Gesellschaft, aktuelle politische Konflikte, politisch bedeutsame Institutionen und Organisationen wird jeweils eine Planungsmethode angeboten, die zu einem systematischen, kritischen und schülerorientierten Unterricht führen.
Der Band basiert auf den Beiträgen der Jahrestagung der Gesellschaft für Geschichtsdidaktik Österreich (GDÖ) 2021. Er bietet einen Einblick in Forschungen, die einen Beitrag zur aktuellen geschichtsdidaktischen Aufgabendiskussion leisten.
Wenn aktuell von einer Krise der Demokratie die Rede ist wird damit häufig die Forderung an historische Bildung erhoben, die freiheitlichen Werte der Bundesrepublik zu vermitteln. Dürfen, ja müssen Geschichtsunterricht und Geschichtsdidaktik darüber hinaus emanzipatorisch ausgerichtet sein?
Dieser Band umreißt eine Methodik des Geschichtsunterrichts, die sich an den Denkweisen der Geschichtswissenschaft orientiert und bei Schülerinnen und Schüler Geschichtsbewusstsein und historische Diskursfähigkeit fördert. Er stellt 20 fachspezifische Erkenntnisoperationen vor und zeigt, wie aus ihnen Unterrichtsmethoden werden können, die Geschichtsunterricht wieder näher an seine Bezugsdisziplin, die Geschichtswissenschaft, rücken. Der Band enthält erste Impulse für die unterrichtspraktische Umsetzung.
Dieser Band klärt die Frage, wie Schweizer Jugendliche die Geschichte ihres Landes erzählen. Aus dem Inhalt („Was?“) und der Struktur („Wie?“) der analysierten Texte erfolgen Vorschläge zur Bewertung historischer Erzählungen von Jugendlichen.
Der Autor zeigt kreative Methoden auf, um Politikstunden abwechslungsreich und schüleraktivierend zu gestalten, ohne notwendige fachliche Lernziele aus den Augen zu verlieren. Mithilfe von exemplarischen Stundenentwürfen für den Inhaltsbereich „Diskriminierung und Rassismus“ wird z. B. die Anwendbarkeit der folgenden Methoden verdeutlicht: Enträtselung einer Quelle, Standbild, Sprechmühle, fiktives Interview, Spinnweb-Analyse, Ich-Texte, Perspektivenwechsel, Phantasiereise, 2-Minuten-Rede, Schreibgespräch, Identifikationskreis, Redekette, außerdem drei neue Methoden: Gruppenstreitgespräch, Sc…
Anlässlich des 54. Historikertages in Leipzig stellt der Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Lutz Raphael, Problemlagen und Themenfelder vor, die mit dem Motto „Fragile Fakten“ verbunden sind. „Faktenchecks“ sind auch für Historikerinnen und Historiker zum Tagesgeschäft geworden, wenn in der Öffentlichkeit über Geschichte gestritten wird. Außerdem geht es u.a. um politische Manipulation der Vergangenheit zu Zwecken der Propaganda und der Heroisierung politischer Gemeinschaften, um die wissenschaftstheoretische Klärung historischer „Tatsachen“ als komplexe Konstrukte historischer Forschung und um wissenschaftsethische Fragen, wie mit kritischen Fakten in Wissenschaft und Öffentlichkeit umzugehen ist.Ulf Thiel nimmt den Historikertag zum Anlass, über die Geschichte der Stadt Leipzig, ihrer Universität und des dortigen Geschichts(lehrer)studiums zu informieren.
Wie ist Mündigkeit heute zu verstehen? Was heißt „Kritik“ in der politischen Bildung? Was bedeutet kulturelle Identität für die Aufgaben politischer Bildung? Wo gibt es Grenzen der Kontroversität und was bedeutet das für das Handeln von Lehrkräften? Wolfgang Sander bezieht die didaktischen Grundlagen aus seinem Buch „Politik entdecken - Freiheit leben“ auf diese neuen Herausforderungen für politische Bildung in den Krisen und Konflikten unserer Zeit. Dabei plädiert er, nach dem Auslaufen der Kompetenzorientierung, für eine Neubesinnung auf den Begriff der Bildung als Leitidee politischer B…
Dieses Buch stellt Ansätze ökonomischer Bildung in verständlicher Form vor. Als fachdidaktischer Kompass liefert es Leitbilder für das Handeln von Lehrkräften. Es fördert ihr professionelles Selbstverständnis und eine innovative Praxis. Der Band erschließt und vergleicht die Vielfalt der Wirtschaftsdidaktiken. Er behandelt eine Grundfrage des Wirtschaftsunterrichts und eignet sich als Basistext in der Ausbildung von Lehrkräften. Durch sein systematisches Vorgehen bietet er Orientierung in einem unübersichtlichen Feld.
Krise, Krieg(sfolgen), Inflation ... Der Blick aus dem Jahr 2023 auf die Geschehnisse 100 Jahre zuvor lohnt sich in vielfacher Hinsicht. Im Jahr 1923 bündelten sich in Deutschland die einschneidenden, katastrophalen Erfahrungen der vergangenen Jahre: ein Krieg in einer bis dahin unbekannten, nicht einmal erahnten Dimension; die verheerenden Niederlage, die noch dazu als überraschend, unverdient und unerklärlich erlebt wurde; die Revolution, der sich schier unendliche Umsturzversuche, Aufstände, politische Morde, Putsche von rechts wie von links anschlossen; die Hyperinflation, die den Mittelstand beinahe vollständig enteignete; ein Friedensdiktat, das Deutschland umfängliche Gebietsabtretungen und auf Jahrzehnte Reparationen in Milliardenhöhe auferlegte; schließlich die Besetzung des Ruhrgebiets und der vergebliche Versuch, sich im „Ruhrkampf“ den Alliierten zu widersetzen. Kaum einer der Zeitgenossen überstand diesen Wirbel der Veränderungen, der Leidenschaften und des Irrsinns unbeschadet. Dass es dennoch gelang, die Republik nach noch einmal zu stabilisieren, mutete die Zeitgenossen wie ein Wunder an.
Die Studie „Geschichte und Gesellschaftslehre“ wendet sich historischen Lehr-Lern-Prozessen in Unterrichtsreihen zu. Wie gestalten sich die Anbahnung und Performanz historischen Lernens in Unterrichtsreihen? Welche Lerneffekte lassen sich beschreiben? Die Studie ist in der Phänomen-, Ergebnis- und Wirkungsforschung angesiedelt und kombiniert Videographien, Lehrer*inneninterviews und Schüler*innenbefragungen. Das Untersuchungsdesign aus Vor- und Nacherhebung, Unterrichtsvideographie und Stabilitätsmessung ermöglicht auch Erkenntnisse zur Stabilität historischer Lernprozesse in den Themenfel…
Der Band versammelt Impulse zum Diskursstand sowie empirische Studien und konzeptionelle Überlegungen zur Visual History und ihren Potenzialen in der historisch-politischen Bildung. Er widmet sich dabei vielfältigen Visualia und den sie betreffenden (geschichtskulturellen) Distributions- und Verarbeitungsstrategien.