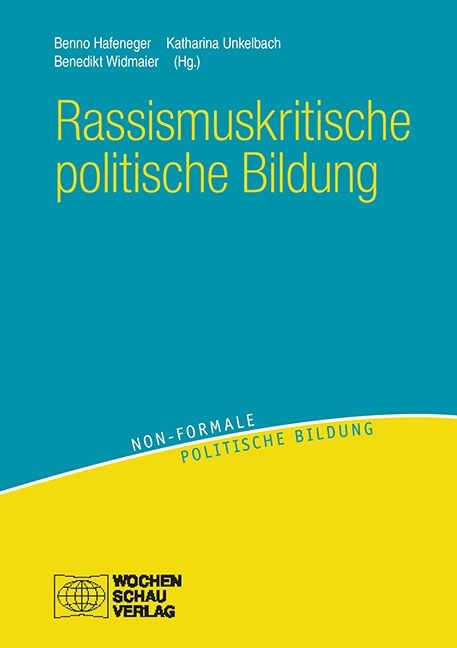-
Programm
- Unterrichten
-
Jugend- & Erwachsenenbildung
- Zeitschriften
- Jugendbildung
- Beutelsbacher Konsens
- Engagement
- Europawahl
- Demokratie stärken
- Integration
- Rassismuskritische Bildungsarbeit
-
Vorurteile und Rechtsextremismus
- Alltagsdiskriminierung entgegentreten
- Erwachsenenbildung
- Non-formale politische Bildung
- Antisemitismus
- 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
- WeRemember
- Pädagogik
- Soziale Arbeit
- Sachbuch
- Handbücher
- Wissenschaft
- Neuheiten
- Zeitschriften
- Schule
- Wissenschaft
- Open Access
- elibrary
- Reihen
- Autor*innen
- Kontakt
2019 und 2020 forderte der rechte Terror in Hessen elf Todesopfer. Dabei gilt das Bundesland mit vergleichsweise gering ausgeprägten extrem rechten Strukturen und einer relativ niedrigen Zahl an Gewalttaten nicht als rechte Hochburg. Wie passt das zusammen? Um Antworten zu finden haben Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch die Geschichte rechten Terrors in Hessen nach 1945 aufgearbeitet. Dabei werden Gewalttaten und die dahinterliegenden Strukturen rekonstruiert, zeitgeschichtlich eingeordnet und in ihren Entwicklungen analysiert. Die faktenreiche Arbeit liefert erstmals eine umfassende Darstellung rechten Terrors und kommt zu dem Ergebnis, dass sich dieser wie ein roter Faden durch die Geschichte Hessens zieht. Podcast-Folge zum Buch Am 19. Februar 2020 wurden 9 Mitmenschen in Hanau von einem rassistischen Attentäter kaltblütig ermordet. In Politische Bildung - Der Podcast waren Yvonne Weyrauch und Sascha Schmidt eingeladen, um über ihr Buch „Rechter Terror in Hessen“ zu sprechen. Video-Interview zum BuchYvonne Weyrauch und Sascha Schmidt haben mit Moment Mal!, einer Bürgerinitiative aus Wiesbaden, über ihr Buch gesprochen.
Seit 2017 hilft LOVE-Storm tausenden Menschen, Hass im Netz mit digitaler Zivilcourage zu begegnen. Das Trainingshandbuch kombiniert praktische Strategien und relevantes Hintergrundwissen mit Übungen und Lehrmaterialien: Für alle Pädagog*innen, die sich mit Hatespeech, Cybermobbing und digitaler Zivilcourage auseinandersetzen und sich und ihre Schüler*innen vor Netzangriffen schützen wollen.
Schule und Unterricht müssen sich vermehrt mit rechtsextremen Herausforderungen auseinandersetzen. Zahlreiche Publikationen beleuchten in diesem Zusammenhang präventive Handlungsmöglichkeiten. Die Besonderheit dieser Arbeit liegt dagegen darin, dass sie die Herausforderungen in der Auseinandersetzung mit schon rechtsextrem eingestellten Schülerinnen und Schülern in den Blick nimmt. Der Autor beschäftigt sich auf der Basis qualitativer Interviews mit Wahrnehmungen, Deutungen und Handlungsstrategien von sächsischen Politiklehrerinnen und -lehrern. Die Arbeit zeigt, wie Pädagoginnen und Pädagogen in Situationen reagieren, welche Handlungsmaximen für sie entscheidend sind und welche Konsequenzen ihr Handeln (oder Nicht-Handeln) für rechtsextrem Eingestellte, für die Klasse als Ganzes, für sie selbst und für die politische Bildung hat. Im letzten Teil der Arbeit werden pragmatische Hilfen angeboten, wie Lehrerinnen und Lehrer Unsicherheiten im Umgang mit rechtsextremen Schülern überwinden können.
Die Schnellste, der Weiteste, das Beste: Das Extreme kann eine große Anziehungskraft ausüben. Dies gilt auch für das politisch Extreme. In einer Gesellschaft, in der Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist, kann man sowohl durch extreme Leistungen als auch durch extreme politische Ansichten auffallen und dadurch Aufmerksamkeit erhalten. Die Verbreitung von extremistischer Propaganda ist durch die sozialen Medien viel einfacher geworden als in Rundfunk und Printmedien, denn im Internet gibt es bislang kaum wirksame Kontrollmechanismen, wie sie sich in den älteren Medien etabliert haben. Auf diese Weise können extremistische Gruppen mit relativ geringem Aufwand eine größere Anzahl an Menschen erreichen als je zuvor. Dies ist eine Herausforderung nicht nur für die politische Bildung, sondern auch für Jugendhilfe, Polizei, Schule, Sozialarbeit und Medienpädagogik.
Welchen Herausforderungen zum Umgang mit religiöser Vielfalt müssen sich Praktiker*innen in ihrer alltäglichen Arbeit stellen? Das Praxishandbuch bietet Fallanalysen und Handlungsperspektiven in den Bereichen Medien, Politik/Verwaltung, Bildung, Zivilgesellschaft und am Arbeitsplatz. Anhand von Nordrhein-Westfalen wird deutlich, dass es einer Sensibilisierung und Bewusstseinsschaffung bedarf, um die Herausforderungen zu bewältigen. Das Praxishandbuch richtet sich an Praktiker*innen, denen die Vielfalt der Religionen begegnet, an Forscher*innen, die diese untersuchen, sowie an interessierte Bürger*innen.
Judenfeindschaft aus unterschiedlichen Motiven – religiösem Ressentiment, kulturellem Vorbehalt, ökonomischer und sozialer Ausgrenzung, rassistischem Hass – kulminierte unter nationalsozialistischer Ideologie im 20. Jahrhundert im Völkermord. Der Judenhass lebte fort, daneben entstand nach dem Holocaust ein mit neuen Argumenten operierender Antisemitismus, der Scham- und Schuldgefühlen entspringt. Der oft beschworene „neue Antisemitismus“ ist dagegen nichts anderes als die monotone Judenfeindschaft mit ihren Stereotypen, Legenden, Unterstellungen und Schuldzuweisungen, die sich in Jahrhunderten entwickelt hat. Antisemitismus ist ein zentrales Element des Rechtsextremismus, aber er kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Doch nicht nur Judenhasser bieten Anlass zur Sorge. „Islamkritiker“ denunzieren pauschal alle Muslime als Judenfeinde und Überengagierte versuchen, Antisemitismus auf die Haltung gegenüber Israel zu verengen und beziehen in ihr Verdikt jede kritische Haltung zur israelischen Politik mit ein. Objektive Kriterien, was Antisemitismus ist, wie er sich historisch entfaltete, in welchen Formen er vorkommt, wie Judenfeindschaft von Israelkritik abzugrenzen ist, sind für eine differenzierte Betrachtung unentbehrlich. Informationen und Argumente dazu finden sich in diesem Buch.
Der Kampf um die Deutungshoheit des Heimatbegriffs wird nicht nur auf der Straße, im Netz und in den Parlamenten geführt – sondern auch in der Musik. Der Einblick in verschiedene Spektren der rechten Musik zeigt: Die vermeintlich unpolitische Deutschrock-Band „Frei.Wild“, die neurechten Rapper „Komplott“ und „Chris Ares“ sowie der neonazistische Liedermacher „Frank Rennicke“ verbreiten ein völkisches Heimatverständnis, das für eine vielfältige Gesellschaft brandgefährlich ist. Das Buch ist ein analytisches Werkzeug für Lehrer*innen und Praktiker*innen in der Jugendarbeit.
In diesem Band wird das viel diskutierte Phänomen der "Krise der Demokratie" aus der Perspektive verschiedener Fachwissenschaften analysiert. Ausgehend von dem Begriff einer "multiplen Krise" befassen sich die Beiträge mit (sozio)ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der aktuellen Krise. Prominente Autor*innen gehen der Frage nach, welchen Einfluss der Neoliberalismus auf Demokratie und Menschenrechte hat und wie sich die Entwicklung vom Neoliberalismus hin zum Illiberalismus vollzogen hat. Daran anknüpfend werden Tendenzen des Autoritarismus sowie Ideologie und Strategie der populistischen und extremen Rechten in Zeiten der 'multiplen Krise' beleuchtet. Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, welchen Beitrag politische Bildung zur Überwindung der Krise der Demokratie leisten kann. Diese Fragen werden von ausgewiesenen politischen Bildner*innen nicht nur auf theoretischer Ebene diskutiert, sondern anhand konkreter Praxisbeispiele illustriert.
„Shrinking Spaces“ ist ein Begriff, der bisher vor allem im Kontext von Politik und Entwicklungszusammenarbeit bekannt ist und beschreibt die Zunahme schwindender Handlungsräume für zivilgesellschaftliche Organisationen in autokratischen Systemen. Doch zeigen sich auch in den etablierten Demokratien einzelne, aber immer deutlich konturiertere Facetten, welche von Shrinking Spaces zeugen. Legt man diese einzelnen Bruchstücke nebeneinander, so wird das Mosaik immer deutlicher, welches die zunehmende Einschränkung von Handlungsspielräumen der Zivilgesellschaft visualisiert. Der vorliegende Schwe…
Der Umgang mit den rassistischen Gewalttaten des NSU ist ein Lehrstück dafür, wie Rassismus von Menschen ausgeblendet werden kann, die davon nicht betroffen sind. Die Autor_innen gehen der Frage nach, welche gesellschaftlichen Mechanismen auch heute dazu beitragen, dass Rassismus oftmals nicht wahrgenommen wird, gleichwohl aber Wirkung für die Betroffenen entfaltet. Handlungsfelder wie etwa Schule, Medien, Sicherheitsbehörden oder Formen des öffentlichen Erinnerns werden auf „Leerstellen“ mit Blick auf Rassismus beleuchtet.
Beratung im Kontext Rechtsextremismus unterstützt Menschen im Umgang mit extrem rechten und menschenfeindlichen Tendenzen. Der Band bietet einen Einblick in verschiedene Beratungsfelder, Methoden und Positionen dieser jungen Profession.
Einst Antisemitismus, jetzt Anti-Migranten-Stimmung: Abwehr und Hass behindern zukunftsorientiertes und humanes Handeln. Integrationsbereitschaft Neuankommender bedarf des Integrationswillens der aufnehmenden Gesellschaft. Dies ist möglich und in Gesellschaften wie der kanadischen aktive Praxis. „Wir schaffen es nicht“ führt zu Stillstand, Passivität und Angst. Aktive Gestaltungsbereitschaft ist gefordert, von Einzelnen, auf gesellschaftlicher Ebene, von Politiker_innen. Die Autor_innen zeigen Möglichkeiten guten Zusammenlebens von Ankunft und Aufnahme über Kindergarten, Schule und Arbeitsmarkt bis zu voller Teilhabe und Teilnahme.
Will man das Phänomen Populismus begreifen, ist es hilfreich, in verschiedene Disziplinen – z. B. Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Wahlforschung, Journalismus – zu blicken. Dieser Sammelband macht durch interdisziplinären Austausch die Bandbreite an vorhandenen Konzepten sichtbar und nutzt die Erkenntnisse aus unterschiedlichen Bereichen, um über die Weiterentwicklung von Möglichkeiten der schulischen Politischen Bildung im Umgang mit Populismen zu diskutieren. Dabei werden etwa folgende Fragen behandelt:• Welche Begegnungszonen zwischen Politischer Bildung und Populismus gibt es?• Handelt es sich beim Begriff „Rechtspopulismus“ um eine Verharmlosung von „Rechtsextremismus“?• Welche Wirkungen haben populistische Kommunikationsstile in sozialen Medien auf junge Menschen?• Welche Relevanz haben Politik- und Demokratievorstellungen von Lernenden für die Ausgestaltung didaktischer Konzepte?Damit wird ein Beitrag dazu geleistet, die Herausforderung Populismus besser zu verstehen und diese – besonders im schulischen Umfeld – stärker als bisher zu berücksichtigen.
Wie entsteht Rassismus? Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen Sprache und Rassismus beobachten? Sollte rassismuskritische Bildung nicht eine Querschnittsaufgabe aller Bildungsarbeit sein? So steht vor dem Hintergrund neuer bundespolitischer Programme zur Extremismusprävention und Demokratieförderung nicht nur die non-formale politische Bildung vor neuen Herausforderungen, Klärungsprozessen und Selbstverständnisdebatten. Die Autorinnen und Autoren des Bandes widmen sich der vielschichtigen Ausdifferenzierung der rassismuskritischen Bildung: Neben dem Thema Antisemitismus werden auch Kolonialismus sowie Nachhaltigkeit und Globalisierung behandelt. Auch Rassismus im Kontext von Populismus und Rechtsextremismus kommt zur Sprache. Unterschiedliche Institutionen werden im Hinblick auf Rassismus (-kritik) betrachtet. Zudem finden sich im Band medienpädagogisch und -analytisch orientierte Beiträge. Dabei wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag politische Bildung leisten kann, um Rassismus präventiv und aktiv entgegenzutreten. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar - eine kurze Mitteilung an uns genügt!
Obwohl in Gesellschaft und politischer Bildung weithin Konsens bei der Anerkennung und Verteidigung der Demokratie besteht, entzünden sich an kaum einem Thema derart scharfe Kritiken wie an dem des politischen Extremismus. Das Handbuch für die politische Bildungsarbeit führt kompakt in diese Debatte ein und klärt in Teil I einschlägige Begriffe und historische Entwicklungslinien. Teil II analysiert die antidemokratischen Strömungen der Gegenwart in Deutschland: Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus und fasst die Ergebnisse der politik- und sozialwissenschaftlichen Extremismusforschung zusammen. Teil III weitet den Blick auf das Thema im europäischen Zusammenhang, Teil IV widmet sich dem Demokratieschutz und geeigneten Interventionsansätzen.
Der Leitfaden bietet in zehn Kapiteln erstmals in dieser elementaren Form sprachliches, psychologisches und kulturelles Basiswissen zur Rhetorik der Herabsetzung. Welche Tabus, welche kognitiven Barrieren müssen wir überwinden, um die Macht verbaler, aber auch visueller Herabsetzung zu durchbrechen? Wie sich zeigt, kann die konkrete Analyse herabsetzender Aussagen und Texte neue emanzipative Kompetenzen und Energien für die kulturelle und politische Handlungsfähigkeit vermitteln. Allen, die pädagogisch, journalistisch und politisch tätig sind, bietet der Leitfaden Anstöße zur nachhaltigen Reflexion und Kommunikation. Für Studium, Workshops und die Weiterbildung wird weiterführende Literatur angegeben.
Identitätspolitik ist ein schillernder Begriff. Einige bezeichnen mit ihm die Prozesse, über die diskriminierte Minderheiten gemeinschaftlich gestärkt werden. Andere sehen in ihm eine Ablenkung von den Problemen der Mehrheitsgesellschaft. Und wieder andere verwenden ihn als Synonym für einen neuen Nationalismus oder ähnliche, auf die Essentialisierung sozialer Verhältnisse gerichtete Kommunikationsformen. In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es weitere Kontroversen. Diese betreffen u. a. das Verhältnis von Identitätsfragen und Verteilungskonflikten. Oft werden diese beiden Dimensionen scharf voneinander abgegrenzt. Verteilungskonflikte sind verhandelbar und durch Kompromisse auflösbar, Identitätskonflikte erscheinen hingegen als substanziell. Mitunter werden identitäts- und verteilungspolitische Konflikte aber auch als komplementäre, wechselseitig aufeinander bezogene Prozesse betrachtet. Und manchmal wird in der Debatte darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Praxis eigentlich schwer vorstellbar ist, dass politische Prozesse ohne identitätspolitische Dimensionen auskommen. Allerdings werden diese Dimensionen meistens nur implizit, seltener explizit thematisiert. Dies hat sich in den letzten Jahren nun allerdings verändert. Die unterschiedlichen identitätspolitischen Prozesse sind wiederholt und verstärkt in den Vordergrund getreten. Für POLITIKUM stellen sich daher viele Fragen: Gibt es eine neue Qualität der Identitätspolitik? Falls ja, wie stellt sich diese Qualität dar? Wie hat sich das Feld identitätspolitischer Praktiken entwickelt und verändert? Welche Ursachen können für den Wandel verantwortlich gemacht werden? Welche Akteure und Arenen sind dabei in den Blick zu nehmen? Und was sind die Folgen für die bestehenden Formen demokratischer Partizipation und Entscheidungsfindung? Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen ist lohnend. Denn selbst wenn der Begriff der „Identitätspolitik“ zuweilen recht unscheinbar daherkommen mag, artikulieren sich in ihm unterschiedliche Facetten einer auseinanderdriftenden Gesellschaft.
Vorurteile, Radikalisierung und Extremismus sind aktuell drängende Probleme in nahezu allen Gesellschaften. Der vorliegende Band beinhaltet psychologische und andere sozialwissenschaftliche Beiträge von namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit den Grundlagen und Möglichkeiten einer wirksamen Prävention dieser Probleme und der Förderung von Toleranz befassen. Die Arbeiten verstehen sich damit als Beitrag zu einer toleranten Gesellschaft, die soziale und kulturelle Diversität nicht als Problem, sondern als Errungenschaft begreift.
Dieses kulturelle Bildungsprogramm zur antisemitismuskritischen Extremismusprävention will Bildungsschaffenden Einblicke in gelingende primärpräventive Bildungsarbeit im Kontext von Schule ermöglichen und zur Weiterentwicklung selbstswirksamkeitsfördernder Programme anregen.