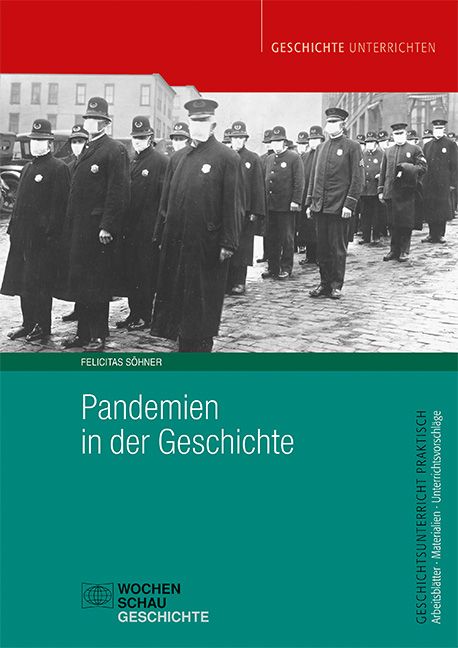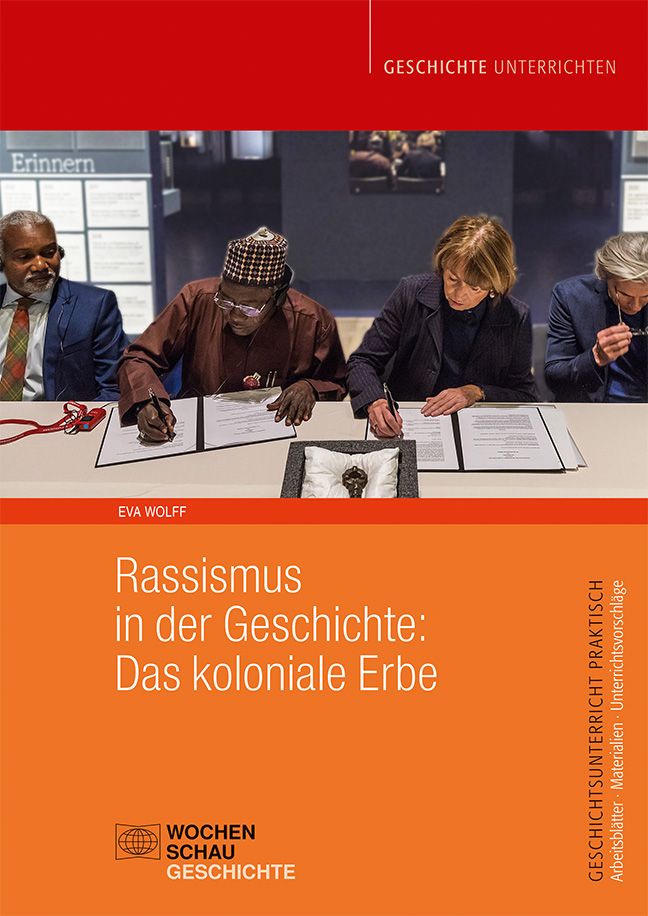„Meiner Ansicht nach ist es sehr, sehr früh, um loszugehen und einen Sarg für die Globalisierung zu kaufen.“ (Kristalina Georgiewa, Chefin des Internationalen Währungsfonds) Politische Figuren wie Donald Trump haben mit ihren protektionistischen Handelspolitiken der Globalisierung den Krieg angesagt, aber ist die Globalisierung damit am Ende? Schüler*innen der Sekundarstufe II erkunden in diesem Basisheft fall- und problemorientiert globale Kontroversen, die die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen betreffen. Die Frage, ob Globalisierung sozialverträglich und gerecht gestaltet werden kann, nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Nach der Bearbeitung dieser WOCHENSCHAU können sich die Schüler*innen ein fundiertes Urteil zu Fragen der globalen Wirtschaftsbeziehungen bilden.
Das Basisheft eröffnet vielfältige und schüler*innennahe Zugänge zum Lehrplanthema und bietet abwechslungsreiche methodische Zugänge. Die besondere Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen und umstrittene Fragen des Jugendschutzes werden ebenso thematisiert wie die Problematik der Selbstjustiz. Anhand von anschaulichen Materialien und aktuellen Fällen setzen sich die Schüler*innen der Sekundarstufe I mit grundlegenden Fragen und Kontroversen rund um Recht in Gesellschaft und Staat auseinander.
Die Hoffnung auf einen unaufhaltsamen Siegeszug der liberalen Ordnung, auf ein "Ende der Geschichte" trog. Seit Jahren steigt die Zahl gewaltsamer Konflikte. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig, und ein totgeglaubter Wiedergänger spielt dabei eine gewichtige Rolle: der Nationalismus. In vielen Regionen der Welt werden bestehende Grenzen im Namen einer ruhmreichen Vergangenheit und zur „Heimholung“ von „Volksangehörigen“ oder „verlorenen Gebieten“ in Frage gestellt, werden nationale Interessen außer- und innerhalb internationaler Vereinigungen robust bis rücksichtslos durchgesetzt. Die Abkehr vom „Multilateralismus“ und „Institutionalismus“ in den internationalen Beziehungen ist nicht zu übersehen. Auf dem Balkan brodelt es bedrohlich.Doch es gibt nicht nur diese hässliche Fratze des Nationalismus. In Afrika spielte er als Befreiungsideologie eine wichtige Rolle, wenn auch nicht immer zum Segen der betroffenen Völker. Dem schottischen Nationalismus sind völkische Elemente gänzlich fremd. Es ist folglich ein facettenreiches Bild, das sich beim Blick auf den Nationalismus als politische Idee und Praxis ergibt.
In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und wie können wir uns daran beteiligen? Diesem Gestaltungsauftrag geht politische Bildung nach. Dabei legt politische Bildung in der Grundschule häufig den Fokus auf Projekte und Aktionen. Dieses Buch zeigt, wie Schülerinnen und Schüler im Sachunterricht systematisch an das Ziel politischer Bildung – politische Mündigkeit – herangeführt werden können. In diesen Kontext gehört unmittelbar auch das in dieser Einführung vorgestellte fachliche und fachdidaktische Wissen zur Vermittlung politischer Bildung in der Grundschule.Im Zentrum dieses B…
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Zugang zu Songs als einer vernachlässigten (Quellen-)Gattung. Die ausgewählten Songtexte zeigen einen thematischen Querschnitt durch verschiedene Jahrzehnte, umrahmt von didaktischen Impulsen und Vorschlägen für den Unterricht.
Entdecken Sie bisher unveröffentlichte Karikaturen zu lehrplanrelevanten Inhalten der NS-Zeit. Multiperspektivisch und doppelseitig aufbereitet mit Interpretation, Intention, Urteil und Aufgaben. Bereichern Sie Ihren Geschichtsunterricht!
2024 jährt sich der Geburtstag Immanuel Kants zum dreihundertsten Mal. Welche Relevanz haben die Schriften des Philosophen für uns heute und wie lassen sie sich im Geschichtsunterricht vermitteln? Ulrich Bongertmann geht dieser Frage anhand der Schrift "Vom ewigen Frieden" nach, die Wege zu einer dauerhaften Friedensordnung diskutiert, heute ein höchst aktuelles Thema. Auch der Beitrag von Christoph Kampmann beschäftigt sich mit der Deutung von Friedens- und Sicherheitsordnungen in der Frühen Neuzeit. Als Einstieg in das Schwerpunktthema erläutert der Kurator der großen Kant-Ausstellung in der Kunsthalle Bonn Konzeption und Rezeption der Ausstellung.
1848. Revolution in Deutschland! Einer der Anführer des Volksaufstands: Robert Blum. Er kämpft für den Sieg der Bürger über die Herrschaft der Fürsten – erst mit Worten im Frankfurter Parlament, zuletzt mit der Waffe in der Hand auf den Wiener Barrikaden.175 Jahre ist die „48er Revolution“ nun her – aber der Kampf Robert Blums und der anderen frühen Demokraten für das allgemeine Wahlrecht, für Volksherrschaft, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit inspiriert noch heute. "Tod im Morgengrauen. Robert Blum und die Revolution von 1848" zeigt, warum es sich auch im 21. Jahrhundert noch lohnt, für Freiheit, Recht und Demokratie einzustehen. Eine mitreißende Geschichte mit zusätzlichen Sachkapiteln sowie einem umfangreichen Anhang.Ab 14 Jahren
17 aktivierende Methoden führen zur Methodenvielfalt und einen lebendig gestalteten Geschichtsunterricht, der fachlich intensive Lernprozesse anstrebt, den SchülerInnen häufiger das Wort gibt, sie auch kognitiv-produktiv herausfordert, ihnen ermöglicht sich in historischen Rollen zu erleben, der neue Wege für ein empathisches Verstehen eröffnet und methodisch mehr Angebote für Präsentationen bietet. Eine 10-stündige Unterrichtseinheit auf der Basis von Autobiographien jüdischer Häftlinge, die Auschwitz und Bergen-Belsen überlebten, belegt exemplarisch die Gestaltungskraft dieses umfassend e…
Die Methodenhandreichung stellt Bildungsformate für die schulische und außerschulische Europabildung vor, die auf aktuellen Studien basieren und sich an der Lebenswelt Jugendlicher, ihren Wünschen, Fragen und Interessen orientieren.
Zwei kulturelle Outreach-Programme geben Einblicke in gelingende Bildungsarbeit, in Strukturen und Dynamiken antisemitismuskritischer Bildungsprogramme und veranschaulichen dabei die Rolle des Museums als Lern- und Bildungsort.
Soll sich der Staat überhaupt in die Ernährung der Bürger*innen einmischen? Wenn nicht: Wer oder was bestimmt dann, was zu welchen Herstellungsbedingungen und mit welchen gesundheitlichen Konsequenzen auf unseren Tellern landet?
Die Kopiervorlagen erleichtern Lehrkräften den unkomplizierten Start in die kompetenzorientierte Arbeit mit Comics. Dabei werden verschiedene Comicarten, von Epochalepos bis hin zum Graphic Diary, für unterschiedliche Schulstufen aufbereitet.