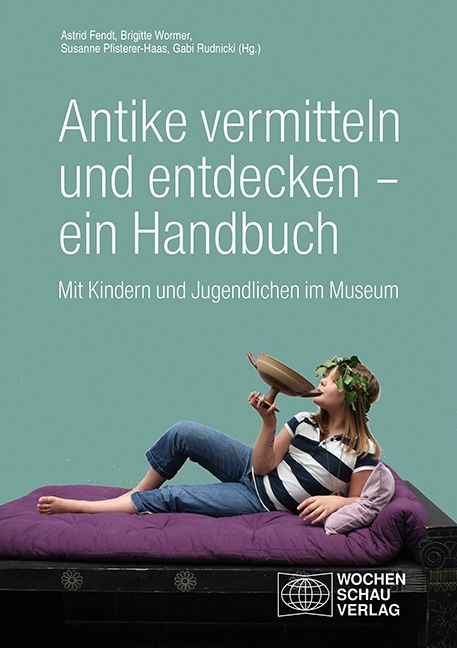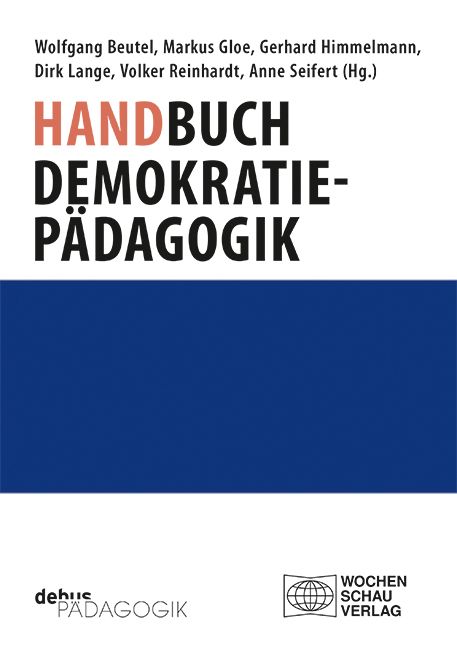- Programm
- Zeitschriften
- Schule
- Wissenschaft
- Open Access
- elibrary
- Reihen
- Autor*innen
- Kontakt
Janusz Korczak gilt als Pionier der Kinderrechte. Dieser Band bietet eine fachübergreifende Auseinandersetzung mit der Frage nach der Anschlussfähigkeit von Korzcaks Ideen für Gesellschaften des 21. Jahrhunderts.
Konflikte sind in der Demokratie zentral. Experinnen und Experten beleuchten gesellschaftliche Konfliktfelder sowie demokratische Umgangsformen und Lösungsansätze. Erfahren Sie, wie Konflikte als Chance für demokratische Bildung genutzt werden können.
Die Autor*innen dieses Sammelbandes befassen sich mit der Konzeption und praktischen Umsetzung von Lernzeiten an Ganztagsschulen. Sie bieten Einblicke in neuere Forschungsergebnisse und Beispiele von Lernzeitkonzepten in verschiedenen Schularten.
Die Entwicklung von ganztägigen Bildungs- und Lebensorten bringt Angehörige unterschiedlicher Berufe zusammen. Die in diesem Manual erprobten Methoden zeigen, wie teambasierte Arbeit gelingen kann, um das Potenzial ganztägiger Bildung auszuschöpfen.
Museen spielerisch erfahren! Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben und richtet sich an alle, die mit Kindern und Jugendlichen im Museum arbeiten. Der Fokus liegt auf der methodisch vielfältigen Vermittlung in Antikensammlungen und archäologischen Museen. Die zahlreichen Praxisbeispiele sind aber ohne großen Aufwand auch auf andere Museumstypen und die Arbeit mit Erwachsenen übertragbar. Weitere Praxisbeispiele werden als Onlinematerial zur Verfügung gestellt. Das Buch regt dazu an, Besucher*innen mit verschiedensten Bedürfnissen, Motivationen und Interessen in differenzierten Formaten und zielgruppengerecht anzusprechen. Ein Theorieteil behandelt grundlegende Themen der Vermittlung im Museum.
Die klassische stadtgeschichtliche Dauerausstellung hat ausgedient! Dieser Band schlägt ein Modell vor, das den Erfordernissen aktueller Einwanderungsgesellschaften Rechnung trägt, indem es glokal verankerte – vor Ort aufzeigbare, aber darüber hinausweisende – Interpretationsangebote macht.
In drei Bänden setzen sich Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik mit der Geschichte des Internationalen Bundes seit der Gründung bis 2019 auseinander, einem großen Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. Der erste Band befasst sich auf Basis umfangreichen historischen Materials mit den verschiedenen Aspekten der Gründung und wirft damit auch ein gesellschaftspolitisch interessantes Licht auf die Übergänge von der Nazi-Diktatur zu den ersten beiden Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik. Wie hat sich der IB in seinen Anfängen gesellschaftlich und politisch positioniert? Welche Konzepte und Programme zur Integration von Jugendlichen wurden in der Frühphase des IB entwickelt und realisiert? Wie gestaltete sich der Weg von einem regionalen zu einem bundesweiten Träger mit einem vielfältigen Angebot von Bildungs- und Sozialarbeit? Wissenschaftliche Expertisen zu zentralen Themen rund um die Gründungsgeschichte des IB ergänzen diese Veröffentlichung ebenso wie Kurzbiografien der wichtigsten Gründungspersönlichkeiten und ein Überblick über die ersten Gremien und Mandatsträger. Der zweite Band setzt diese Auseinandersetzung fort und widmet sich besonders folgenden Themen:• dem Erbe des gerade besiegten Nationalsozialismus und der Wirksamkeit personeller Kontinuitäten; • der Bedeutung einer europäisch orientierten emanzipatorischen Pädagogik und politischen Bildung;• der Rolle der Nachkriegspolitik, insbesondere die der SPD, bei der fachpolitischen Positionierung des IB im Nachkriegsdeutschland;• der Begründung und Gestaltung der engen Partnerschaft zwischen IB und Deutschem Roten Kreuz;• den mit den 1970er Jahren einsetzende Reform- und Öffnungsprozessen im IB;• dem heutigen Umgang des Unternehmens IB mit seinem Erbe. Der dritte Band zur Geschichte des Internationalen Bundes (IB) schließt an die beiden Bände „Gründungsgeschichte des Internationalen Bundes“ und „Von Altlasten und Neuanfängen“ an und umfasst 50 Jahre, nämlich den Zeitraum von 1969 bis 2019. Die Entwicklungen der Pädagogik in Ost und West zwischen 1969 und 1989 werden von renommierten Wissenschaftler*innen nachgezeichnet und die wichtigsten Felder des IB von Praktiker*innen vorgestellt. Dabei erfährt der Entwicklungsschub durch die Wiedervereinigung und die Entwicklung des IB in der ehemaligen DDR besondere Aufmerksamkeit.
Kinder müssen erleben, dass ihre Meinungen gehört und ihre Interessen respektiert werden. In diesem Band berichten Lehrer*innen, Schüler*innen und für Schulentwicklung Engagierte über ihre Erfahrungen. Die Praxisbeispiele werden durch konzeptionelle Überlegungen und Materialien ergänzt, die Schulen dabei unterstützen, die Kinderrechte in ihre Arbeit aufzunehmen.
„Gerechtigkeit“ ist zweifellos kein neues Thema, es hat aber angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen in den Themenfeldern Gesundheit, Klima, Politik, Wirtschaft und Soziales an Relevanz gewonnen. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass eine verstärkte Polarisierung und damit Verschärfung von Ungleichheiten nachweisbar war und die politischen Maßnahmen eher nach dem Gießkannenprinzip erfolgten, während es eigentlich passgenauer Instrumente bedurft hätte. Gerechtigkeit und Ungleichheit bleiben damit gesellschaftliche Herausforderungen und drängende politische Fragen, die auch unter…
Diese Bibliografie erfasst mehr als 2.000 Veröffentlichungen zum Thema Ganztagsschule/Tagesschule aus dem deutschen Sprachraum in gedruckter und digitaler Form, die in den Jahren 2010 bis 2021 erschienen sind. Für die Texte, die im Internet kostenfrei zur Verfügung stehen, sind zudem die entsprechenden Link-Adressen angegeben. Das Verzeichnis wendet sich an Interessierte und mit dem Thema Ganztagsschule in Theorie und/oder Praxis Befasste wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in der Schulverwaltung Tätige sowie an Lehrkräfte und das weitere pädagogische Personal.
Partizipation zu ermöglichen ist eine Aufgabe für Kita, Schule und den kommunalen Raum. Partizipation gelingt, wenn nicht primär bloße Wissensvermittlung im Fokus steht, sondern handelnd (selbst-)gemachte Erfahrungen und Kompetenzentwicklung. In diesem Buch werden anhand von Erfahrungsberichten aus verschiedenen Einrichtungen Anforderungen, Gelingensbedingungen sowie mögliche Ansätze, Formate und Entwicklungsprozesse gelingender Partizipation reflektiert. Fachleute und Beteiligte, Lehrkräfte und Schüler*innen äußern sich in Aufsätzen, Berichten, Gesprächen und Anleitungen. Zahlreiche vertiefe…
Die Thematisierung von Jugend ist ein wiederkehrendes gesellschaftliches und pädagogisches Phänomen. Der Band bietet einen Überblick über Jugenddebatten, das Generationenverhältnis, Jugend und Jugendkulturen im Wandel und vermittelt Anregungen für den Umgang mit der jungen Generation.
Seit 2017 hilft LOVE-Storm tausenden Menschen, Hass im Netz mit digitaler Zivilcourage zu begegnen. Das Trainingshandbuch kombiniert praktische Strategien und relevantes Hintergrundwissen mit Übungen und Lehrmaterialien: Für alle Pädagog*innen, die sich mit Hatespeech, Cybermobbing und digitaler Zivilcourage auseinandersetzen und sich und ihre Schüler*innen vor Netzangriffen schützen wollen.
Die Zielperspektive des „forschenden Lehrers“ steht im Mittelpunkt dieses Methodentrainings. Es werden Forschungsmethoden dargestellt, die Lehrkräfte bei der Erforschung, Diagnostik und Evaluation im sozialwissenschaftlichen Unterricht einsetzen können. In jedem Beitrag werden zentrale theoretische Aspekte zu den dargestellten Forschungsmethoden erläutert, mindestens ein Anwendungsbeispiel dargestellt sowie Übungsmaterial oder Planungshilfen für die Erprobung im Unterricht präsentiert. Lehrerinnen und Lehrer erhalten damit eine alltagsnahe Hilfe zur Umsetzung der eigenen Unterrichtsforschung.
Mittels einer aufwändigen Verlaufsstudie, die den Werdegang von 346 Kindern über einen Zeitraum von 18 Jahren abbildet, wird das Verhältnis von selbstständigen Facheinrichtungen des Kinderschutzes und den Jugendämtern als ihren Auftraggebern analysiert.