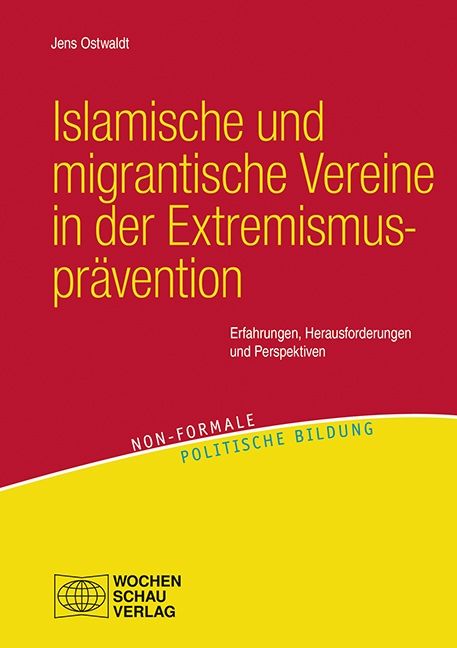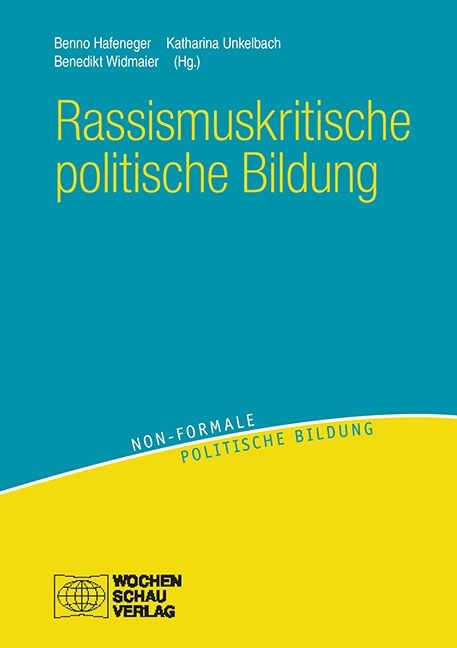Shape the Future
Digitale Medien in der politischen Jugendbildung
- herausgegeben von
- Ole Jantschek, Klaus Waldmann
- unter Mitarbeit von
- Guido Brombach, Petra Grell, Michael Grunewald, Uwe Jakubczyk, Ole Jantschek, Ann-Katrin Knemeyer, Jöran Muuß-Merholz, Simone Schad-Smith, Burkhard Schmidt, Tobias Thiel, Klaus Waldmann
Welche Chancen ergeben sich aus der Entwicklung des Internets zum Mitmachnetz und durch die rasante Verbreitung von sozialen Medien unter Jugendlichen für die politische Jugendbildung? Die Beiträge dieses Bandes geben anregende Einblicke in vielfältige Praxisprojekte: Neue Formate wurden erprobt und digitale Medien zur Erkundung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, zur Visualisierung von Wünschen, zur Artikulation von Interessen, zur Präsentation von Forderungen und zur Kommunikation mit Entscheidungsträgern eingesetzt. Im Vordergrund standen die Ideen, Online- und Offline-Medien in…
Dieser Titel ist leider in gedruckter Form vergriffen, ggf. jedoch weiterhin als PDF erhältlich.
| Bestellnummer: | 40011 |
|---|---|
| EAN: | 9783734400117 |
| ISBN: | 978-3-7344-0011-7 |
| Reihe: | Non-formale politische Bildung |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Auflage: | 1. Auflage 2016 |
| Seitenzahl: | 192 |
- Beschreibung Welche Chancen ergeben sich aus der Entwicklung des Internets zum Mitmachnetz und durch die rasante Verbreitung von sozialen… Mehr
- Inhaltsübersicht Zur EinführungKlaus Waldmann und Ole Jantschek Die Bildung im digitalen Wandel – zwischen Abwehrschilden und Trojanischen Pf… Mehr
- Autor*innen Guido Brombach studierte Pädagogik an der Universität Essen. Seit seiner Diplomarbeit zum Thema „Grenzen und Möglichkeiten k… Mehr
- Stimmen zum Buch "Vor allem für Praktiker/-innen im Bereich der politischen Jugendbildung liefert der kleine Band […] einige Anregungen gerad… Mehr
Welche Chancen ergeben sich aus der Entwicklung des Internets zum Mitmachnetz und durch die rasante Verbreitung von sozialen Medien unter Jugendlichen für die politische Jugendbildung?
Die Beiträge dieses Bandes geben anregende Einblicke in vielfältige Praxisprojekte: Neue Formate wurden erprobt und digitale Medien zur Erkundung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, zur Visualisierung von Wünschen, zur Artikulation von Interessen, zur Präsentation von Forderungen und zur Kommunikation mit Entscheidungsträgern eingesetzt. Im Vordergrund standen die Ideen, Online- und Offline-Medien in der Praxis zu verknüpfen, die Tools des Web 2.0 anzuwenden, mit digitalen Medien kreativ zu arbeiten und Ansätze der Partizipation zu stärken. Weiter werden Anregungen für eine zukünftige Praxis im dynamischen Feld der außerschulischen politischen Bildung formuliert.
Zur Einführung
Klaus Waldmann und Ole Jantschek
Die Bildung im digitalen Wandel – zwischen Abwehrschilden und Trojanischen Pferden
Ein Streitgespräch zwischen Guido Brombach und Jöran Muuß-Merholz
Konzept, Fragestellungen und Ziele des Projekts „Shape the Future“
Klaus Waldmann
Digitale Medien in der Praxis politischer Jugendbildung
A) Lokale Sozialräume gestalten
1. Schweriner StadtRaumLabor – Zwischen Paulskirche und Facebook
Burkhard Schmidt
2. Wo sind Plätze für Jugendliche?
Google Maps und Minecraft als Tools der Stadt- und Regionalentwicklung
Tobias Thiel
3. Mein Haus – meine Gemeinde – mein Leben
Michael Grunewald
B) Ideen und Aktionen zur Beschäftigung mit globaler Zukunft
1. Zukunftsideen statt Krise
Jugendliche bloggen ihre Wünsche und Visionen für Europa
Ole Jantschek, Simone Schad-Smith
2. „Klima.Camp“
Von der Tagung zum Schülernetzwerk KliMotion
Simone Schad-Smith
3. „Mach’s grün!“ – Jugendliche entwickeln Ideen für nachhaltiges Leben in der Stadt
Ole Jantschek
4. Internationaler Aktionstag für Klimagerechtigkeit
Ann-Katrin Knemeyer
C) Spielerische Erkundungen mitCaches und Apps
1. Meine Stadt – meine Rechte – meine Welt
Geocaching in der politischen Bildung mit Kindern
Tobias Thiel
2. Die vireale Stadt – eine Stadterkundung mit Actionbound
Michael Grunewald
3. Der Natur auf der Spur – mit Geocaching und Actionbound
Uwe Jakubczyk
D) Jugendbeteiligung und das Mitmachnetz
1. Online und vor Ort
Engagement mit Storytelling, Kampagnen und vernetztem Arbeiten
Ole Jantschek
2. Netzpolitischer Salon
Crossmediale Akademiearbeit zu Themen der digitalen Gesellschaft
Tobias Thiel
Zur Relevanz der Arbeit mit digitalen Medien in der politischen Jugendbildung
A) Herausforderung für Bildung: Veränderungen im Umgang mit Information und Kommunikation verstehen
Petra Grell
B) Neue Formate politischer Jugendbildung
Uwe Jakubczyk, Burkhard Schmidt
C) Digitale Spielwelten in der politischen Jugendbildung
Michael Grunewald, Tobias Thiel
D) Politisches Handeln in der digitalen Demokratie
Ann-Katrin Knemeyer, Ole Jantschek
E) Perspektive Zukunft als Fragestellung in der politischen Jugendbildung
Klaus Waldmann
Perpetual Beta? – Die Praxis politischer Jugendbildung und der digitale Wandel
Ole Jantschek, Klaus Waldmann
Glossar
Literatur
Autorinnen und Autoren
Guido Brombach studierte Pädagogik an der Universität Essen. Seit seiner Diplomarbeit zum Thema „Grenzen und Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und ihre Implementierung in Computerlernprogrammen“ beschäftigt er sich mit dem schmalen Grat, auf dem Lernen und digitale Medien aufeinandertreffen. Seit 2000 arbeitet er für das DGB-Bildungswerk im Bereich der politischen Computer- und Medienbildung. Er ist einer der Mitbegründer der Plattform „pb21 – Web 2.0 in der politischen Bildung“, www.pb21.de.
Petra Grell, Professorin für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der Technischen Universität Darmstadt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Bildung in einer digital geprägten Kultur, interaktiven Medien in institutionellen Lehrkontexten, Partizipation und Ausgrenzung sowie Spielen und Spielerfahrungen in digitalen Welten. Sie ist Vorsitzende des Networks „Open Learning, Media, Environment and Cultures“ der European Educational Research Association (EERA).
Michael Grunewald, Diplom-Soziologe, seit 2001 Fachreferent im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit den Schwerpunkten Politische Jugendbildung und Digitale Welt. Er konzipiert insbesondere Veranstaltungen für Zielgruppen, die diesen Themen reserviert gegenüberstehen. Seit 2006 wirkt er als Jugendschutzsachverständiger in der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) mit, die als freiwillige Einrichtung der Computerspielewirtschaft Alterskennzeichen nach dem Jugendschutzgesetz vergibt.
Uwe Jakubczyk, Pfarrer, Spiel- und Theaterpädagoge, Coach, seit 2004 Studienleiter und Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Zuvor war er Bildungsreferent im Bereich Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, davor Pfarrer und Kreisjugendpfarrer im Kirchenkreis Hofgeismar. Schwerpunkte seiner Arbeit mit Jugendlichen sind die Themen Europa, Jugendpolitik und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Nutzung sozialer Medien im Blick auf Open Education und neues Lernen.
Ole Jantschek studierte Internationale Beziehungen und Osteuropastudien. Seit 2010 arbeitet er für das Netzwerk der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, von 2010 bis 2013 als Studienleiter an der Evangelischen Akademie Frankfurt, seit 2014 in der Bundesgeschäftsstelle
in Berlin. Zuvor konzipierte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin unter anderem E-Learning- und Blended-Learning-Module im Themenfeld Internationale Beziehungen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Digitale Demokratie, Europäische Bürgerschaft und Historisch-politische Bildung in Europa. Er ist Vorsitzender der Kreisau-Initiative e. V., www.kreisau.de.
Ann-Katrin Knemeyer, Sozialwissenschaftlerin (M.A.), ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Sozialwissenschaftliche Energieforschung am Institut für ZukunftsEnergieSysteme in Saarbrücken. Bis 2013 war sie Referentin für gesellschaftspolitische Jugendbildung mit den Themenschwerpunkten Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und Klimagerechtigkeit im Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Sie leitete die Jugendklimakampagne für die Evangelische Jugend in Westfalen und initiierte einen Internationalen Aktionstag für Klimagerechtigkeit.
Jöran Muuß-Merholz ist Diplom-Pädagoge und betreibt mit einem kleinen Team die Agentur J & K – Jöran und Konsorten. Er arbeitet an den Schnittstellen zwischen Bildung und Lernen und Medien und Kommunikation. Insbesondere berät er Bildungseinrichtungen hinsichtlich der Frage, wie sie digitale Medien sinnvoll in ihrer Arbeit einsetzen können. Von 2010 bis 2014 koordinierte er die Arbeit der Webseite pb21.de – Web 2.0 in der politischen Bildung. Texte, Termine und Projekte von Jöran Muuß-Merholz finden sich unter www.joeran.de.
Simone Schad-Smith, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, ist seit 2004 als Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Loccum tätig. Dort ist sie für die Tagungen mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II verantwortlich, die sich mit den großen globalen Gestaltungsaufgaben befassen: Frieden und Sicherheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie gerechte Ökonomie. Vor ihrer Tätigkeit in Loccum hat sie unter anderem als Arbeitswissenschaftlerin an der Universität Hannover gearbeitet.
Burkhard Schmidt, Diplom-Religionspädagoge, seit 1992 Studienleiter für Jugendbildung an der Evangelischen Akademie der Nordkirche, Standort Rostock. Zuvor war er mit der evangelischen Jugendarbeit auf Rügen beauftragt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Veränderungen in der Mediengesellschaft, die gesellschaftliche Beteiligung Jugendlicher und der Generationendialog. In Seminaren, Tagungen und Trainings setzt er sich für den aktiven und verantwortlichen Umgang mit digitalen Medien als politisch wirksames Handeln ein.
Tobias Thiel, Politikwissenschaftler (M.A.), ist seit 2006 Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e. V. Seine Arbeitsschwerpunkte 1sind Politische Bildung mit Kindern, Partizipation von Jugendlichen und Medienpädagogik. In seinen Angeboten versucht er, diese Schwerpunkte miteinander zu verbinden, indem er zum Beispiel Geocaching mit Kindern als Teil eines Partizipationsprozesses nutzt. Ergebnisse der Projekte finden sich auf Web- und Facebook-Seiten der Jungen Akademie Wittenberg: http://junge-akademiewittenberg.de.
Klaus Waldmann, Diplom-Pädagoge, war bis April 2016 Bundestutor der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung und Leiter des Projekts „Shape the future“. Seit Mai 2016 ist er als freiberuflicher Dozent in der Fort- und Weiterbildung tätig.
"Vor allem für Praktiker/-innen im Bereich der politischen Jugendbildung liefert der kleine Band […] einige Anregungen gerade zu der Frage, wie eben verschiedene SocialMedia-Elemente bzw. digitale Tools mit Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen eingesetzt werden können. Dabei weisen die Autor/-innnen auch immer wieder selbstkritisch auf falsche Erwartungen und andere Schwierigkeiten in der Praxis hin."
aksb-inform, Ausgabe 1/2017
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Was passiert mit Kindern und Jugendlichen, die in diesen Zeiten erwachsen werden? Wenn man kaum mehr weiß, wo man hinschauen soll, weil es überall auf der Welt brennt: Griechenland, Ukraine, der Nahe Osten, globale Flüchtlingsströme, die Anschläge von Paris und überall auf der Welt? Man könnte Pessimist werden oder Weltverneiner, Eskapist, Einzelgänger – oder Schlimmeres. Stattdessen geschieht etwas Verblüffendes: Die 12- bis 25-Jährigen sind optimistischer, idealistischer und sogar politischer als die Generationen davor, zumindest wenn man der aktuellen Shell Jugendstudie Glauben schenkt, die im Oktober 2015 erschienen ist. 62 % der jungen Menschen seien sich sicher, dass sie eine gute Zukunft haben werden, 52 % sind optimistisch im Hinblick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, so die Studie. Zudem haben junge Menschen weniger Sorgen vor Krankheit, schlechter Wirtschaftslage und Arbeitsplatzverlust. Dass sie sich selbst gut entwickeln werden, davon waren auch die Jahrgänge davor überzeugt, dass es dem Land gut gehen wird, ist neu. Wie konnte es zu diesen Entwicklungen inmitten immerwährender Krisen kommen? Wie soll man da Optimist werden, politisch interessiert sein, gesamtgesellschaftliches Engagement entwickeln? Die anpackende Zuversicht der Jugendlichen, allesamt Digital Natives und gut vernetzt, macht Hoffnung. 46 % der befragten Jugendlichen gaben an, politisch interessiert zu sein. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass gerade junge Menschen ehrenamtlich engagiert sind; 72 % der befragten Jugendlichen sind oft oder gelegentlich für andere aktiv. Hauptinformationsquelle und, so die Shell Studie, „Leitmedium“ der Jugendlichen für politische Themen ist zu allererst das Internet. Dabei ist das Netz einerseits Informationsmedium, aber gleichzeitig auch Ort und Werkzeug des Engagements und bietet damit neue Potentiale für die Teilhabe junger Menschen. Dieses Heft beschäftigt sich mit der umfassenden Mediatisierung der Gesellschaft, die mit einem durch die Netzkommunikation verursachten kategorialen Wandel von Öffentlichkeit und Privatheit einhergeht. Dabei wandeln sich digitale Diskurse und digitale Öffentlichkeit(en) nachhaltig. Gleichzeitig entsteht durch den andauernden Strukturwandel politischer Kommunikation eine moderne politische Kommunikationselite, die sich spezifische Möglichkeiten von Partizipation und Teilhabe erschließt und Avantgarde einer zukünftigen Beteiligungsdemokratie sein kann, in der kollektive Entscheidungen unter der weitgehenden Teilhabe aller Bürger/-innen diskutiert werden. Auch mit dem Wandel digitaler Medien und deren Rezipienten, den medienpädagogischen Voraussetzungen für einen gefahrlosen und nachhaltigen Umgang mit dem Web 2.0 sowie den Möglichkeiten digitalen Engagements befasst sich dieses Heft intensiv.
Die Frage nach gesellschaftlichen Transformationen steht im Mittelpunkt zahlreicher Debatten der letzten Jahrzehnte. Durch die sich inzwischen seit fast sechs Jahren überschlagenden Krisen hat sie eine besondere Brisanz bekommen. Nicht nur die ökonomischen Verwerfungen, auch das Entstehen neuer sozialer Bewegungen und die politischen Umwälzungen und andauernden Konflikte im arabischen Raum stellen die Transformationsforschung vor neue Aufgaben. Nicht zuletzt die Diskussion um eine Krise der Demokratie, die durch die jüngsten europäischen Ereignisse täglich neue Nahrung bekommt, oder die Debatte zur Postdemokratie zeigen zudem, dass Transformation nicht notwendig „Fortschritt“ bedeuten muss. Diesen makrostrukturellen politischen Veränderungen entspricht gleichzeitig ein Wandel der Subjektivität. Veränderte Arbeitsverhältnisse (Prekarisierung), veränderte Kommunikationsformen (Neue Medien), Umbrüche in den Geschlechterverhältnissen und eine wachsende soziale Marginalisierung gehen nicht spurlos an Individuen vorüber. „Transformationen des Selbst“ stehen ihrerseits in einem engen Zusammenhang mit übergreifenden sozialen Veränderungen. Beide Dimensionen sozialer Transformation sind auch eine Herausforderung für politische Bildung. Zum einen, weil Bildungssysteme selbst den Transformationsprozessen unterworfen sind; zum anderen, weil politische Bildung vor der Aufgabe steht, diese Prozesse zu reflektieren und diskutierbar zu machen. Im Mittelpunkt des Bandes stehen programmatische Beiträge und Forschungsvorhaben aus der formalen und non-formalen politischen Bildung.
Non-formale politische Bildung
Partizipation und Politikdistanz, demokratisches Handeln und Rechtspopulismus. Das Buch präsentiert vielfältige Eindrücke in Einstellungen Jugendlicher zu Demokratie und Politik und lotet Potenziale der Jugendverbände aus. Wie können Jugendverbände demokratisches Handeln unterstützen? Welchen Beitrag kann die Pfadfinder:innenbewegung, einer der größten Jugendverbände, konkret leisten? Welche praktischen Erfahrungen gibt es? Eine spannende Lektüre zu einem oft vernachlässigten Bereich demokratischen Lernens und politischer Bildung.
Die Autor*innen dieses neuen Bands befassen sich aus klassismuskritischer Perspektive u. a. mit sexueller Bildung, queerer Jugendbildung, Geschlechterbildung, Antisemitismus und Heteronormativität. Sie gewähren Einblicke in Empowerment-Projekte, veranschaulichen verschiedene emanzipatorische Herangehensweisen und werfen konstruktive Fragen für die Weiterentwicklung der außerschulischen politischen Bildung auf.
Bildungsfreistellung als bildungspolitisches Instrument wird kontrovers diskutiert. Die Studie analysiert aus der subjektiven Perspektive von Teilnehmenden, welche Wirkungen und Effekte die Mehrfachteilnahme an entsprechenden Veranstaltungen hat.
Wie engagiert sich die jüngere Generation? Wofür steht sie ein? Welche Protestformen wählen sie? Das Buch präsentiert Einblicke in die Protestkultur junger Menschen aus vielen verschiedenen Perspektiven.
Zeit für Bildung ist im Lebenslauf der Menschen ungleich verteilt. Während sie im Kinder- und Jugendalter überwiegt, wird sie im Erwachsenenalter zu einem raren Gut. Die Zuteilung oder Verteilung von bzw. die Verfügung über Bildungs- und Lernzeiten unterliegt zudem spezifischen gesellschaftlichen Aushandlungs- und Verhandlungsprozessen. Dies betrifft v. a. den Zugang zur betrieblichen Weiterbildung, der innerbetrieblichen Steuerungsprozessen unterliegt. Dagegen erhalten Erwachsene im Rahmen von Bildungsfreistellungs-, Bildungsurlaubs- und Bildungszeitgesetzen in 14 Bundesländern ein verbrieftes Recht auf frei verfügbare Bildungszeit. Ziel des vorliegenden Sammelbandes ist es, sich aus der Perspektive von Wissenschaft, Bildungspolitik, Bildungspraxis (Träger und Einrichtungen) und aus der Sicht von Teilnehmenden mit den besonderen Implikationen der Bildungszeitgesetze auseinanderzusetzen. Darüber hinaus wird gefragt, welche Bedeutung Zeit für Bildung in vorgeschriebenen Formen der beruflichen Weiterbildung und im Rahmen gesellschaftlicher Transformationsprozesse, wie der Digitalisierung, hat.
Wir erleben aktuell zunehmend demokratiegefährdende politische Tendenzen hin zu den Extremen: Demokratiefeindliche Parteien, aber auch fundamentalistische Gruppen gewinnen an Zuwachs, während viele Menschen, gerade Jugendliche, an Halt verlieren. Es ist eine unserer wichtigsten Herausforderungen, diesen Strömungen entgegenzuwirken.Der Band führt aus Sicht von Jugendsozialarbeit und politischer Bildung Ansätze der Primärprävention gegen Antisemitismus, Rassismus und religiösen Fundamentalismus zusammen. Sie beruhen auf einer wissenschaftlichen Reflexion und fachpolitischen Einordnung der Praxiserfahrungen aus dem innovativen Bundesprogramm RespektCoaches. Konkrete Beispiele zeigen, wie es gelingt, die Lebenswelt junger Menschen, ihre Suche nach Identität und Religion einzubeziehen und Partizipation zu ermöglichen.Das Buch richtet sich an alle, die mit oder für Jugendliche arbeiten und an aktuellen Fachdebatten im Themenfeld Prävention interessiert sind. Insbesondere pädagogischen Fachkräfte in Jugend- und Bildungsarbeit, in der Schulsozialarbeit und in den Jugendmigrationsdiensten kann es als Anregung und Weiterbildung dienen.
Internationale Jugendarbeit ist abhängig von politischen Entscheidungen und entfaltet zugleich eine eigenständige politische Aktivität. Der Autor beschäftigt sich in diesem Buch mit der Frage, wie sich internationale Jugendarbeit als politisches Handlungsfeld konstituiert. Hierzu wird der politiktheoretische Begriff der "politischen Differenz" und seine Verarbeitung im bildungstheoretischen Diskurs sowie in Ansätzen der politischen Bildung rekonstruiert. Damit leistet der Autor einen Beitrag zur theoretisch-konzeptionellen Weiterentwicklung der internationalen Jugendarbeit und entfaltet eine kritisch-emanzipatorische Perspektive, die Bildung und Demokratie ins Zentrum rückt.
Dieser Band blickt im Sinne des Utopischen nach vorne und fragt: Wieviel Utopie braucht die Erwachsenenbildung? Denn pädagogisches Denken kommt ohne Zukunftsentwürfe nicht aus, so die Herausgeberinnen. (Politische) Erwachsenenbildung heißt, sich als mündiger Bürger in der Gesellschaft zu bewegen und neben Kritik- und Urteilsfähigkeit auch eine Utopiefähigkeit zu entwickeln. Wie soll sich sonst etwas ändern? Dabei beginnt der Diskurs bereits bei der Definition: Was ist eigentliche eine Utopie? Die Vielfältigkeit des Nachdenkens über utopische Momente in der Erwachsenenbildung zeigt sich in den Aufsätzen der hier versammelten Autorinnen und Autoren. Sie begegnen ihnen auf unterschiedliche Art und Weise und bieten Anregungen, die (utopische) Welt der Erwachsenenbildung in Theorie und Praxis zu betreten. Das Buch ist der klugen Denkerin Christine Zeuner gewidmet, die in ihrem wissenschaftlichen Wirken stets die Spannungsfelder der Erwachsenenbildung aufspürt.
Die Studie fragt danach, wie sich die Teilhabe an einer Gemeinschaft als Teil des Aufwachsens unter den Bedingungen einer postmigrantischen Gesellschaft realisiert. Wie gelingt es heterogenen Jugendlichen, miteinander Gemeinschaft zu gestalten und welche Rolle spielen dabei kulturelle Unterschiede? Anhand einer standardisierten Befragung und leitfadengestützter Interviews mit Fachkräften, Ehrenamtlichen und Jugendlichen wird analysiert, wie Öffnungsprozesse in konfessionellen Jugendverbänden gestaltet werden können. Die Untersuchung macht deutlich, dass partizipatives Handeln die Grundlage interkultureller Öffnung ist, wenn es darum geht eine Gemeinschaft zu bilden – oder anders gesagt: Nur, wer wirklich teilhaben kann, wird sich auch als Teil unserer Gesellschaft fühlen. In der Jugendverbandsarbeit wird dies exemplarisch sichtbar.
Islamische und migrantische Vereine gelten als wichtige Akteure in der Extremismusprävention. Bisher fehlt es jedoch an Erkenntnissen darüber, welche Rolle sie in der Präventionsarbeit einnehmen (können) und mit welchen spezifischen Herausforderungen sie dabei konfrontiert sind. Die Untersuchung macht deutlich, dass sich islamische und migrantische Vereine in einem erheblichen Spannungsfeld von gesellschaftlicher Erwartung und der Verantwortung gegenüber der eigenen Community befinden. Der Band bietet auf Grundlage einer bundesweiten qualitativen Interviewstudie konkrete Handlungsempfehlungen für die präventive Praxis und die politische Bildung.
Politische Bildner*innen können aufgrund ihrer beruflichen Position teilweise Macht über andere ausüben. Die pädagogische Berufsethik muss sich daher explizit mit Fragen der Manipulation, Indoktrination und Propaganda auseinandersetzen, um die Legitimität ihrer pädagogischen Praxis in unterschiedlichen Kontexten und Formaten zu gewährleisten. Tetyana Kloubert beleuchtet im vorliegenden Buch Erfahrungen im Umgang mit Propaganda und Indoktrination in der Praxis von Civic Education in den USA.
Wie entsteht Rassismus? Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen Sprache und Rassismus beobachten? Sollte rassismuskritische Bildung nicht eine Querschnittsaufgabe aller Bildungsarbeit sein? So steht vor dem Hintergrund neuer bundespolitischer Programme zur Extremismusprävention und Demokratieförderung nicht nur die non-formale politische Bildung vor neuen Herausforderungen, Klärungsprozessen und Selbstverständnisdebatten. Die Autorinnen und Autoren des Bandes widmen sich der vielschichtigen Ausdifferenzierung der rassismuskritischen Bildung: Neben dem Thema Antisemitismus werden auch Kolonialismus sowie Nachhaltigkeit und Globalisierung behandelt. Auch Rassismus im Kontext von Populismus und Rechtsextremismus kommt zur Sprache. Unterschiedliche Institutionen werden im Hinblick auf Rassismus (-kritik) betrachtet. Zudem finden sich im Band medienpädagogisch und -analytisch orientierte Beiträge. Dabei wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag politische Bildung leisten kann, um Rassismus präventiv und aktiv entgegenzutreten. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar - eine kurze Mitteilung an uns genügt!
In der Fachdiskussion um Grundbildung und in der praktischen Bildungsarbeit ist die Dimension politischer Grundbildung bisher wenig beachtet. Der Sammelband bringt diese Diskussion voran und verfolgt eine Annäherung an Inhalte, Begriff und Zielgruppen sowie an die praktische Umsetzung politischer Grundbildung. Politische Grundbildung verfolgt das Ziel, Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind oder ausgeschlossen werden, eine bessere politische Partizipation zu ermöglichen. Die Beiträge regen dazu an, Grundbildung kritisch zu reflektieren. Darunter fällt auch die Kernfrage, wer mit welchen Interessen (politische) Grundbildung definiert, fördert und ausgestaltet.
Welche Chancen ergeben sich aus der Entwicklung des Internets zum Mitmachnetz und durch die rasante Verbreitung von sozialen Medien unter Jugendlichen für die politische Jugendbildung? Die Beiträge dieses Bandes geben anregende Einblicke in vielfältige Praxisprojekte: Neue Formate wurden erprobt und digitale Medien zur Erkundung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, zur Visualisierung von Wünschen, zur Artikulation von Interessen, zur Präsentation von Forderungen und zur Kommunikation mit Entscheidungsträgern eingesetzt. Im Vordergrund standen die Ideen, Online- und Offline-Medien in der Praxis zu verknüpfen, die Tools des Web 2.0 anzuwenden, mit digitalen Medien kreativ zu arbeiten und Ansätze der Partizipation zu stärken. Weiter werden Anregungen für eine zukünftige Praxis im dynamischen Feld der außerschulischen politischen Bildung formuliert.
Als Anfang 2011 in ganz Ägypten Aufbruchsstimmung herrschte, waren viele in der westlichen Welt überrascht: Gut ausgebildete junge Menschen forderten soziale und politische Beteiligung; zivilgesellschaftliche Einrichtungen arbeiteten mit nicht-offiziellem Status; neue demokratische Ideen nahmen Form an. Nur wenige Fachleute hatten die Entstehung einer kritischen Gegenöffentlichkeit in arabischen Ländern – auch in Ägypten – bereits im Gefolge von 9-11 bemerkt. Beteiligte an Austauschprogrammen mit Ägypten lernten über Jahrzehnte die Entwicklung nicht-staatlicher Einrichtungen im Schatten des Mubarak-Regimes kennen. Sie erlebten, wie die junge Generation in Ägypten heranwuchs, die im Jahr 2011 den politischen Wandel einleitete. Dieses Buch fasst die Erfahrungen von 20 Jahren Austauscharbeit mit Ägypten vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der arabischen Welt zusammen. Anhand der durchgeführten Projekte beschreibt es die Inhalte, Lernprozesse und Wirkungsgeschichte politischer Bildung in einer internationalen (und interkulturellen) Konstellation. Gleichzeitig werden die Erfahrungen dieser Zusammenarbeit zu den Analysen (der Fachliteratur und zum Diskurs) in den Referenzwissenschaften in Beziehung gesetzt. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit den Themenschwerpunkten politische Rahmenbedingungen und Förderung, dem sensiblen Überschneidungsfeld von Religion und Politik, mit Demokratiebegriff und demokratischer Entwicklung, mit Strukturen und Gestaltung der Zivilgesellschaft, den Erfahrungen in multilateralen Projekten, der Kurz- und Langzeitwirkung politischer Bildung und den Perspektiven der Zusammenarbeit mit arabischen Ländern. Die Publikation richtet sich an Fachkräfte, Trainer/innen und Fördergeber, die das Aktions- und Wirkungsspektrum politischer Bildung im internationalen Kontext reflektieren möchten. Gleichzeitig bietet es wertvolle praktische Anregungen für die Arbeit mit Gruppen aus Europa und der arabischen Welt.
Es macht einen Unterschied, ob Menschen sich für Menschenrechte, Vielfalt und Miteinander einsetzen oder passiv rassistische und antisemitische Parolen, Übergriffe und Morde hinnehmen. Angesichts der Gefahr, die von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus für plurale Gesellschaften ausgeht, bündelt der Sammelband fachkundige Analysen, lebhafte Berichte und solide Empfehlungen für demokratisches Gegenengagement. Erfahrene PraktikerInnen und ausgewiesene WissenschaftlerInnen thematisieren Fallstricke und Gelingensfaktoren für erfolgreiches zivilgesellschaftliches Engagement. Dabei gehen sie von der Situation vor Ort aus, analysieren schonungslos auch staatliche Bewältigungsprobleme und vermessen Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene. Das Buch befasst sich mit Beispielen aus der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik und stellt diese zweisprachig vor. Česko-německý sborník. Je opravdu velký rozdíl, jestli se lidé zasazují o lidská práva, roz-manitost a mírumilovné soužití, nebo jestli pasivně přijímají rasistická a antisemitská hesla, útoky a vraždy. V souvislosti s nebezpečím, které pro pluralitní společnosti představuje pravicový extremismus, antisemitismus a rasismus, jsou v tomto sborníku shromážděny odborné analýzy, poutavé zprávy a fundovaná doporučení pro demokratickou angažovanost. Zkušení odborníci z praxe a renomovaní vědci tematizují nástrahy a faktory úspěchu pro zdařilou angažovanost občanské společnosti. Vycházejí přitom ze situace na daném místě, bez skrupulí také analyzují obtíže při řešení problematiky ze strany státu a zvažují možnosti angažovanosti občanské společnosti na místní, regionální, národní a transnacionální úrovni. Kniha se zabývá příklady ze Spolkové republiky Německo a z České republiky a prezentuje je v obou jazycích. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar – eine kurze Mitteilung an uns genügt!
Stichworte wie „Vergangenheitsbewältigung“ oder „Erinnerungskultur“ waren nicht nur konstitutiv, sondern lange Zeit auch prägend für das Selbstverständnis der Politischen Bildung in Deutschland nach 1945. Gerade im Zusammenhang mit den sich häufenden Erinnerungsjahren stellt sich deshalb die Frage, in wie weit Adornos berühmte Formel einer „Erziehung nach Auschwitz“ und seine pädagogische Prämisse und Forderung, „dass Auschwitz nicht noch einmal sei“, heute noch von zentraler Bedeutung für Politische Bildung ist oder sein sollte. Diese Frage ist nicht zu trennen von aktuellen Forderungen, eine historisch-politische Bildung zu entwickeln, die auch den nachfolgenden Generationen und jungen Migranten/innen gerecht werden kann. Weitere aktuelle Herausforderungen für eine zeitgemäße „Politische Bildung nach Auschwitz“ sind der wachsende Rechtsextremismus und die Frage nach einer Europäisierung von Erinnerung. Siebzig Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz knüpft die non-formale Politische Bildung mit der Beteiligung an diesen Debatten an ihre normativ aufklärerischen Traditionen an. Der Band liefert einen wichtigen Beitrag zum Diskurs über Ziele, Aufgaben und Selbstverständnis der Politischen Bildung, der über die oft selbst gesetzten, engen Grenzen von schulischer Politikdidaktik und außerschulischer Politischer Bildung hinaus reicht und Erinnerungspädagogik als gemeinsame Aufgabe in den Blick nimmt. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Der Autor beschreibt eine Vielzahl an Varianten des Konstruktivismus, erklärt lernpsychologische Grundlagen, vermittelt neurowissenschaftliche Erkenntnisse, zieht daraus schließlich didaktische und methodische Folgerungen für die politische Erwachsenenbildung und stellt entsprechende Beispiele vor. Dieses Buch ist mehr als eine erkenntnisreiche, spannende Einführung in die Debatten des Konstruktivismus. Die Leserinnen und Leser erhalten Anregungen und Zugänge, wie Konstruktivismus für die Erwachsenenbildung fruchtbar gemacht werden kann.
Zur ReiheDie außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung findet in vielfältigen Arbeitskontexten statt. Diese Kontexte verknüpft die Reihe non-formale politische Bildung. Die ausgewählten Publikationen der Reihe schlagen alle eine Brücke zwischen theoretischer Reflexion und praktischer Arbeit und sind dadurch eine gewinnbringende Lektüre für alle, die im Feld der Politischen Bildung tätig sind.
Mit der Wirkungsstudie wird erstmals empirisch belegt, wie sich politische Jugendbildung längerfristig auswirkt und in politischen Haltungen sowie politischen Aktivitäten von Teilnehmenden niederschlägt. Dazu haben die Forscher junge Erwachsene biographisch-narrativ interviewt, die etwa fünf Jahre zuvor an Veranstaltungen und Projekten der politischen Jugendbildung teilgenommen haben. Die Analyse der Interviews und Gruppendiskussionen macht deutlich, wie sich diese Bildungserfahrungen – vor dem Hintergrund der jeweiligen Biographie – mit vorhandenen Kenntnissen und Einstellungen verknüpfen und wie sich die jungen Erwachsenen im politischen Raum verorten. Anders als im gegenwartsorientierten und emotional turbulenten Jugendalter sind junge Erwachsene erstmals in der Lage, ihre Entwicklungen und Bildungseffekte zu reflektieren und zu bilanzieren. Erstmals liegt eine träger- und veranstaltungsübergreifende bundesweite Studie vor, die Aussagen darüber erlaubt, wie Jugendliche die Anregungen und Impulse aus Veranstaltungen politischer Bildung in ihrem weiteren Lebenslauf nutzen konnten.
Engagement und Partizipation genießen heute in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Vor diesem Hintergrund ist das in der politischen Bildung traditionsreiche Bildungsziel „Partizipation“ für die eigene Profession zu überprüfen und zu präzisieren: Wie können Theorie und Praxis einer handlungsorientierten politischen Bildung zeitgemäß weiter entwickelt werden und wie kann politische Bildung auf neue gesellschaftliche Herausforderungen und Trends reagieren. Mit den hier dargestellten Ergebnissen eines Projekts an der Schnittstelle von sozialem Engagement und politischer Bildung wird deutlich, dass soziale Erfahrungen sehr gut geeignet sind, die Frage nach dem Politischen im engeren Sinne zu stellen und damit einer Kernaufgabe der politischen Bildung nachzukommen.Der Band beschreibt entsprechende Kooperationen zwischen Schule und außerschulischer politischer Bildung und liefert darüber hinaus Anregungen aus der Wissenschaft.