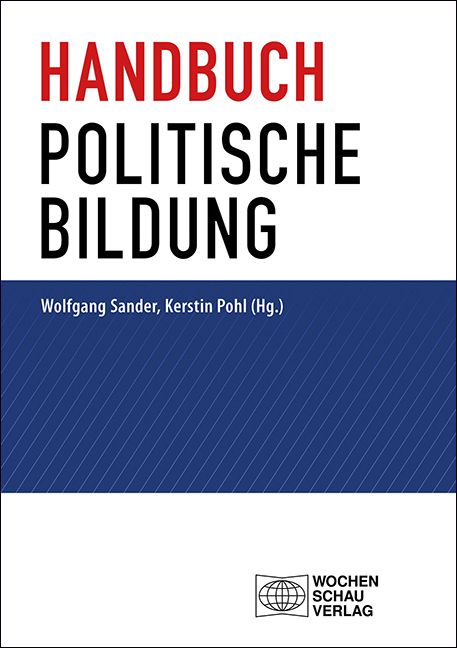Zu "Klaus-Peter Hufer" wurden 38 Titel gefunden
Wie können Schule und Unterricht auf die Herausforderungen des Populismus reagieren? Die Autor*innen dieses Bandes geben Antworten aus der Perspektive der Fachdidaktik und der Bildungswissenschaft. Nach einer politikwissenschaftlichen Einführung werden Handlungsmöglichkeiten in den Sprachen, den Gesellschafts- und den Naturwissenschaften vorgestellt und die Rolle der Medien und der familiären Erziehung diskutiert. Beiträge zu schulrechtlichen Fragen sowie zur Auseinandersetzung mit Stammtischparolen runden den Band ab.
Was bewegt politische Jugend- und Erwachsenenbildner*innen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie und mit welchen Bildungsangeboten reagieren sie darauf? Professionelle Akteure geben Antworten auf diese und andere Fragen. Sie vermitteln Einblicke in ihren beruflichen Alltag und geben Auskunft, wie sie junge und ältere Menschen dazu motivieren, Veranstaltungen der politischen Bildung zu nutzen.
Gerade die deutsche Geschichte lehrt, dass aus einer konsequent demokratischen Staatsform ein in Totalität menschenfeindliches Regime hervorgehen kann. Um die freiheitliche demokratische Grundordnung vor den Feinden der offenen Gesellschaft zu schützen, muss die Achtung von Humanität gleichermaßen Staats- wie Gesellschaftsräson sein. Mit der Neuen Rechten gewinnt in Deutschland und vielen weiteren Staaten eine politische Bewegung an Kraft, die daran arbeitet, die freiheitlichen Grundlagen der Demokratie zu zerstören und stattdessen einen völkischen Nationalismus zu etablieren. Die vorliegende POLIS setzt sich mit dieser Herausforderung für die Demokratie und die Politische Bildung auseinander: Einleitend beleuchtet Klaus-Peter Hufer das Spektrum der Neuen Rechten, setzt sich mit Formen neurechter Agitation auseinander und arbeitet deren ideologische Grundlagen heraus. Joachim von Olberg kontrastiert den völkischen Patriotismus des rechtsextremen Lagers mit einem in der Gegenwart weithin vergessenen liberalen und antinationalistischen Patriotismusverständnis. Sibylle Reinhardt zeigt anlässlich der „AfD-Meldeportale“ und entsprechender Forderungen der Partei, warum aus dem Neutralitätsgebot des Staates kein Neutralitätsgebot der Schule und der Politischen Bildung abgeleitet werden darf. Sebastian Fischer und Sophie Schmitt setzen sich jeweils ganz konkret mit den Aufgaben auseinander, die für die Politische Bildung aus der Erstarkung der extremen Rechten erwachsen. In der Didaktischen Werkstatt schließlich arbeitet der Lehramtsanwärter Tobias Grote Grundlagen einer pädagogischen Handlungskompetenz gegen Menschenfeindlichkeit heraus.
In den vergangenen Jahren hat Sprachbildung als fächerübergreifende Kompetenz Einzug in die bundesdeutschen Lehrpläne genommen. Das übergreifende Ziel ist es, über das Erlernen von Fachsprache bildungssprachliche Fähigkeiten zu erwerben, die gesellschaftliche Teilhabe im weitesten Sinne ermöglichen. Im Rahmen eines klaren Entwicklungskonzeptes von Alltagssprache zu Bildungssprache sind auch die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer aufgefordert, sich mit diesem Thema vertieft auseinanderzusetzen und Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis auszuarbeiten. Mit der Förderung von Sprachkompetenz im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht stellen sich auch grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Sprache und Politik erneut. In einem Überblick erläutert Constanze Spieß aus sprachwissenschaftlicher Perspektive politische Kommunikation und zeigt auf, wie dabei Sprache strategisch genutzt wird. Welche Voraussetzungen und Implikationen das Verhältnis von Sprache und Politik insbesondere für das lernende Subjekt und damit auch für politische Lehr-Lernsituationen hat, arbeitet Marc Partetzke heraus. Annemarie Jordan blickt in ihrem Beitrag darauf, welche Bedeutung Unterrichtsprache im Kompetenzerwerb hat und diskutiert, welche Hürden sich für Schüler*innen im Erreichen politischer Mündigkeit in Verbindung mit der Sprachfähigkeit ergeben können. Sven Oleschko fragt in seinem Beitrag, wie die Forderung nach Sprachbildung im Fachunterricht praktisch umgesetzt werden kann. Er plädiert dafür, den sprachsensiblen Fachunterricht als Chance zu begreifen. In der Didaktischen Werkstatt stellen Sabine Manzel und Claudia Forkarth den Lehr-Lern-Zyklus als praktisches Element zur Sprachbildung im Politikunterricht vor. Auch in der Zeit des coronabedingten Lockdowns hat sich die enge Verbindung zwischen Sprache und Politik gezeigt: So sind beispielsweise in Berlin Transparente und Graffiti genutzt worden, um trotz sozialer Isolation die politische Sprache nicht zu verlieren. Bilder davon finden sich in dieser Ausgabe.
Dieser Band blickt im Sinne des Utopischen nach vorne und fragt: Wieviel Utopie braucht die Erwachsenenbildung? Denn pädagogisches Denken kommt ohne Zukunftsentwürfe nicht aus, so die Herausgeberinnen. (Politische) Erwachsenenbildung heißt, sich als mündiger Bürger in der Gesellschaft zu bewegen und neben Kritik- und Urteilsfähigkeit auch eine Utopiefähigkeit zu entwickeln. Wie soll sich sonst etwas ändern? Dabei beginnt der Diskurs bereits bei der Definition: Was ist eigentliche eine Utopie? Die Vielfältigkeit des Nachdenkens über utopische Momente in der Erwachsenenbildung zeigt sich in den Aufsätzen der hier versammelten Autorinnen und Autoren. Sie begegnen ihnen auf unterschiedliche Art und Weise und bieten Anregungen, die (utopische) Welt der Erwachsenenbildung in Theorie und Praxis zu betreten. Das Buch ist der klugen Denkerin Christine Zeuner gewidmet, die in ihrem wissenschaftlichen Wirken stets die Spannungsfelder der Erwachsenenbildung aufspürt.
Populismus ist ein Politikstil, der gesellschaftliche Ängste katalysiert und sich in Krisenzeiten zu deren Sprachrohr macht. Statt moderne Lösungen zu ermöglichen, führt Populismus zu Ausgrenzung und Denkverboten.Dieser Band analysiert Strukturen in Politik und Geschichte und liefert fachwissenschaftliche Reflexionen sowie konkrete Unterrichtsstunden. Er bietet Materialien zu Themen der Erinnerungskultur und der Mythenbildung, zu Begriffsdefinition und Urteilsbildung. Ein Argumentationstraining und ein Mystery-Rätsel eröffnen handlungsorientierte Vorschläge für die Praxis.
In diesem Band wird das viel diskutierte Phänomen der "Krise der Demokratie" aus der Perspektive verschiedener Fachwissenschaften analysiert. Ausgehend von dem Begriff einer "multiplen Krise" befassen sich die Beiträge mit (sozio)ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der aktuellen Krise. Prominente Autor*innen gehen der Frage nach, welchen Einfluss der Neoliberalismus auf Demokratie und Menschenrechte hat und wie sich die Entwicklung vom Neoliberalismus hin zum Illiberalismus vollzogen hat. Daran anknüpfend werden Tendenzen des Autoritarismus sowie Ideologie und Strategie der populistischen und extremen Rechten in Zeiten der 'multiplen Krise' beleuchtet. Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, welchen Beitrag politische Bildung zur Überwindung der Krise der Demokratie leisten kann. Diese Fragen werden von ausgewiesenen politischen Bildner*innen nicht nur auf theoretischer Ebene diskutiert, sondern anhand konkreter Praxisbeispiele illustriert.
Politische Bildung ist und bleibt eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe, die jede Generation für ihre Belange und in ihrem Interesse weiterentwickeln muss, um den Bestand der Demokratie zu sichern und sie zu stärken. Dabei übernimmt die politische Bildung vielfältige Rollen, die ihr je nach historischer Situation und gesellschaftlichem Bedarf übertragen werden: Sie begleitet und unterstützt politischen und sozialen Wandel, sie antizipiert Veränderungen, sie ist Mitinitiatorin von Umbrüchen, teilweise reagiert sie aber auch nur auf sie. Sie kann eher die Anpassung an politische Verhältnisse zum Ziel haben, aber auch bestehenden Verhältnissen Widerstand entgegensetzen und Alternativen aufzeigen. Über Demokratieentwicklung und die Unterstützung der Handlungsfähigkeit in demokratischen Gesellschaften als Rahmen der politischen Bildung besteht weitgehender Konsens. Unterstellt wird damit auch, dass notwendige Einstellungen und Kompetenzen erlernbar sind. Organisierte politische Bildung wird von Lehrenden vermittelt; Teilnehmende eigenen sich ihre vielfältigen Inhalte an bzw. lernen sie. Damit stellt sich aber neben der Frage nach methodisch-didaktisch sinnvollen Vermittlungsformen von Inhalten auch die Frage nach den (biographischen) Wirkungen – bezogen insbesondere auf die Teilnehmenden, darüber hinaus aber auch auf die Lehrenden und deren berufliches Umfeld. Teilnehmende setzen sich durch den Besuch politischer Bildungsveranstaltungen, der zumeist aus subjektiven Gründen passiert, Erfahrungen aus, die sie sonst vermutlich so nicht machen würden. Die Frage, welche (biographischen) Wirkungen die Teilnahme an politischer Bildung auslösen kann, ist bisher nur in Ansätzen beantwortet. Zu Wirkungen bzw. Effekten politischer Bildung bei Teilnehmenden liegen aktuell sehr wenige empirische Erhebungen und Forschungsergebnisse vor. In den Standardhandbüchern zur politischen Bildung finden sich dazu keine Kapitel, und auch Evaluationen zum Stand der politischen Bildung bzw. zum Bildungsurlaub behandeln das Thema nur am Rande. Die Wirkungsforschung in der politischen Bildung befindet sich in einem Spannungsverhältnis, gleichzeitig liegen bisher nur relativ wenige grundlegende Untersuchungen vor. Der oftmals gewählte Zugang, die Lehrenden zur Motivation der Teilnehmenden zu befragen, gibt – wenn überhaupt – Begründungen für die Teilnahme. Er kann aber keinen Aufschluss darüber geben, welche (langfristigen biographischen) Wirkungen die Teilnahme bei Einzelpersonen hatte. Wissen über diese Fragestellung würde zur Legitimation der politischen Bildung beitragen. Denn es ist anzunehmen, dass Personen durch ihr Denken und Handeln weitere Kreise beeinflussen, als durch die tatsächliche Teilnahme an politischer Bildung erreicht werden. In diesem Kontext versammelt diese Ausgabe des Journals Beiträge, in denen einerseits aktuelle Ergebnisse der Wirkungsforschung zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung dargestellt werden. Anderseits zieht das Heft auch eine vorläufige Bilanz der Wirkungsforschung in der politischen Bildung und diskutiert dabei das Thema insgesamt vor dem Hintergrund bisheriger Studien in Bezug auf seine Relevanz für die Zukunft der politischen Bildungsforschung.
Was sind Stammtischparolen und was kann ihnen entgegengesetzt werden? Klaus-Peter Hufer zeigt Merkmale, Muster und Handlungsmöglichkeiten bei der Konfrontation mit ihnen auf und macht Mut, im Alltag couragiert einzugreifen. Das für diese Auflage aktualisierte und überarbeitete Buch beruht auf der langjährigen Erfahrung des Autors mit dem „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“.
Die seit der Aufklärung und insbesondere der Französischen Revolution machtvoll voranschreitende Säkularisierung und die damit verbundene Herauslösung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus theologisch-kirchlichen Deutungen führte nicht zum Verschwinden der Religionen, doch hat die Religion im pluralistischen Gemeinwesen seitdem einen wesentlich veränderten Stellenwert. Anders als in England und den USA, wo der Aufbau des neuzeitlichen und modernen Staates weitgehend unbelastet von Glaubenskämpfen und staatlich-kirchlichen Konflikten vor sich ging, vollzog sich in Kontinentaleuropa die Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten in scharfer Auseinandersetzung mit Kirche und christlichem Glauben. Dieser war in der Monarchie Staatsräson, in Deutschland noch bis zum Zusammenbruch des Kaiserreiches 1918, wo bis dato eine enge Bindung zwischen staatlicher und kirchlicher Macht – Thron und Altar – herrschte. Über Jahrzehnte war Religion ein eher unterrepräsentierter Themenbereich in den großen politischen Auseinandersetzungen der Bundesrepublik Deutschland. Religionspolitische Fragestellungen und Konflikte werden in der Öffentlichkeit allerdings zunehmend kontrovers diskutiert, und Politiker/-innen unterschiedlicher Couleur betonen nachdrücklich die Bedeutung von Religionen und Glaubensgemeinschaften für Staat, Demokratie und Gesellschaft. Gleichzeitig finden religiöse Transformationsprozesse in der Gesellschaft statt, welche nicht zuletzt durch Zuwanderung beschleunigt werden, und es wird intensiv debattiert, wie mit religiös motivierter Diskriminierung und Gewalt umgegangen werden kann. Obwohl in Deutschland formalisierte religiöse Bindungen abnehmen und die Akzeptanz christlicher Überzeugungen schwindet, kann im Allgemeinen jedoch nicht von einem fortschreitenden Bedeutungsverlust von Religion(en) die Rede sein, im Gegenteil: Die Religion ist in den vergangenen Jahren – spätestens seit 9/11 als eine welthistorische Zäsur sowie als „Chiffre für die Ohnmacht der Aufklärung“ (Arno Orzessek) – mit großer Wirkungsmächtigkeit in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Haben wir es mit einer genuinen Renaissance des Religiösen zu tun oder handelt es sich hierbei um eine Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke? Fest steht zumindest, dass Religion, Macht und Politik sich in einem Spannungsfeld gesellschaftlichen Zusammenlebens befinden und in Zusammenhängen der politischen Bildung immer umfangreicher und kontroverser diskutiert werden. Religion ist demnach wieder ein großes Thema. Wo verschiedene religiös-weltanschauliche Überzeugungen aufeinandertreffen, da entstehen Wertkonflikte, die des öffentlichen Diskurses bedürfen und häufig emotional werden, da solche Dispute die Menschen im Kern ihrer Identität berühren. Gleichzeitig sind sie immer nur einer von vielen Faktoren, aus denen Identität erwächst, wenn auch ein bedeutsamer. Und oft scheint es einfacher, seine religiös-weltanschauliche Überzeugung vorzuschieben, um sich abzugrenzen, anstatt in einen Dialog einzutreten. Unsere Gesellschaft wird pluraler, womit das Potenzial für gesellschaftliche Konflikte, die religiös bzw. weltanschaulich motiviert sind, wächst. Umso wichtiger ist es, einander zuzuhören und in einen sachlichen Austausch darüber einzutreten, welche religionspolitische Gestaltung zukunftsfähig ist: Wie viel und welche religiöse Aktivität verträgt der demokratische Staat? Und wie viel staatliche Regelung vertragen die Religionen? Diesen und anderen Leitfragen im Spannungsfeld „Religion – Macht – Politik“ widmet sich dieses Heft.
Die Autorinnen und Autoren der Publikation diskutieren das Verhältnis von Emanzipation und politischen Bildungsprozessen und setzen sich aus verschiedenen Teilbereichen und Disziplinen (u.a. demokratietheoretisch, sozioökonomisch, lebensweltlich, exklusionskritisch, bildungspraktisch) mit didaktischen Konzepten um Mündigkeit und Aufklärung auseinander.Mündigkeit als Ziel politischer Bildung spiegelt sich am Begriff „Emanzipation“. Doch wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskurse in den didaktischen Strategien wider? Welche Konzepte mündiger BürgerInnenschaft werden verhandelt und welche Herausforderungen ergeben sich im Kontext von Unmündigkeit und kritischer Subjektbildung?Das Grundlagenbuch vereint Beiträge aus Wissenschaft, Hochschullehre und Unterrichtspraxis und richtet sich an Lehrkräfte, MultiplikatorenInnen und DozentInnen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der LehrerInnenbildung.
Die Jahrestagungen der Interessensgemeinschaft Politische Bildung (IGPB) bieten ein wichtiges Forum für die strukturierte Auseinandersetzung mit aktuellen inhaltlichen Anforderungen, vor die sich die Politische Bildung gestellt sieht. Der vorliegende Band fasst die Inhalte der sechsten und siebten Jahrestagung zusammen, in deren Rahmen die Themen „Populismus als Herausforderung für Politische Bildung“ und „Gleichheit und Differenz in der politischen Bildung“ diskutiert wurden.
Rechtsextremismus heute: Nie war das Bild moderner, die Palette der Stile breiter, die Nähe zu den Ausdrucksformen aktueller Jugendkulturen größer. Die neuen Formen sind zeitgemäß und dynamisch, das gewünschte Image ist cool, subversiv und provokant. Die Inhalte sind jedoch im Kern gleich geblieben: rassistisch und demokratiefeindlich. Erlebniswelt Rechtsextremismus – der Begriff steht für Mittel und Strategien, um junge Menschen für diese Szene zu gewinnen. „Rechts“ zu sein verspricht Action, Tabubruch und Anerkennung, zu den Lockmitteln zählen multimediale Angebote im Social Web, Events wie Flashmobs und Konzerte. Gerade an Jugendliche richtet die Szene ihre wichtigsten Werbebotschaften: Kameradschaft und Zusammenhalt in unsicheren Zeiten. Feindbilder verbinden nach innen und können nach außen Türen öffnen. Zurzeit steht vor allem die Hetze gegen geflüchtete Menschen im Mittelpunkt rechtsextremistischer Kampagnen. Die Propaganda sucht den Anschluss an Stimmungen in der Mitte der Gesellschaft. Manchmal gibt sie sich jung und intellektuell, etwa die ‚Identitäre Bewegung‘, die sich als Neue Rechte versteht. Rechtsextremismus im modernen Gewand fordert die politische Bildung heraus. Auch die gründlich überarbeitete Neuausgabe dieses Bandes verbindet Analysen mit Impulsen für die Praxis: 19 Projektskizzen stellen Methoden und Ansätze vor, wie in der Arbeit mit Jugendlichen der kritische Blick auf den Rechtsextremismus geschärft werden kann. Das Onlineangebot, das Leserinnen und Lesern des Bandes mit dieser Neuausgabe zur Verfügung steht, bietet ergänzendes Material zu jedem Beitrag: Aufsätze, Präsentationen und Arbeitsblätter. Die Publikation will Mut machen – Elemente zu erproben, mit eigenen Ideen zu kombinieren und Ansätze fortzuentwickeln.
In kurzer und prägnanter Form wird in dieser handlichen Broschüre das Phänomen Rechtsextremismus beschrieben und der Zusammenhang zu ausländerfeindlichen Parolen hergestellt. Solche "Stammtischparolen" kommen plötzlich und aus der Mitte des Alltags. Wer darauf reagieren will, fühlt sich häufig überrumpelt und überfordert. Doch man kann - und sollte! - ihnen durchaus etwas entgegensetzen.
Dieses Argumentationstraining leistet einen Beitrag, indem es hilft, die eigene politische Urteilsfähigkeit weiterzuentwickeln und die individuelle politische Handlungsfähigkeit auszubauen. Die Autoren greifen Stammtischparolen auf und nehmen die dahinter liegenden Enttäuschungen, Frustrationen und die damit verbundene Wut ernst. und leiten die Leserinnen und Leser dazu an, „Stammtischgespräche“ auf ein höheres „Diskussionsniveau“ zu heben.
Spätestens seit der Tagung im Haus am Maiberg im März 2010, die unter der Themenstellung „Partizipation als Bildungsziel“ organisiert war, ist die Kontroverse über das Verhältnis von Lernen und Handeln in der Politischen Bildung neu entbrannt. Während Vertreter der sogenannten „non-formalen“ Bildung dazu tendieren, das Politik-Machen geradezu als Voraussetzung für nachhaltiges politisches Lernen zu sehen, scheint bei den Repräsentanten der schulischen PolitischenBildung eher die Befürchtung zu überwiegen, dass ein zu enges Verhältnis von politischem Lernen und politischer Aktion möglicherweise zu unzulässigen Grenzüberschreitungen führt. Ein Déjà-vu-Erlebnis wird in diesem Zusammenhang durch Klaus-Peter Hufers Rückblick auf die in den Nachachtundsechziger Jahren vor allem in der politischen Erwachsenenbildung virulent geführten Debatte in Erinnerung gerufen. Daran anknüpfend versucht POLIS in dieser Ausgabe die aktuell konträren Positionen zu profilieren: Während Benedikt Widmaier aus der Sicht der non-formalen Bildung dafür plädiert, zwischen politischem Lernen und politischer Aktion eine enge Verknüpfung herzustellen, erörtert Armin Scherb aus der Sicht der Pragmatistischen Politikdidaktik Möglichkeiten und Grenzen, die im Verhältnis von politischem Handeln und politischem Lernen zu berücksichtigen sind. Als Ergänzung zu den Fachbeiträgen geben im FORUM renommierte Politikdidaktiker und Politikdidaktikerinnen Antwort auf die Frage, was „Handlungsorientierung“in der Politischen Bildung bedeuten soll.In der Didaktischen Werkstatt veranschaulicht Oliver Emde das politikdidaktische Potential „alternativer Stadtrundgänge“, die von zivilgesellschaftlichen Akteurenfür die interessierte Öffentlichkeit, aber auch für Schulklassen und andere Lerngruppen angeboten werden.
Stichworte wie „Vergangenheitsbewältigung“ oder „Erinnerungskultur“ waren nicht nur konstitutiv, sondern lange Zeit auch prägend für das Selbstverständnis der Politischen Bildung in Deutschland nach 1945. Gerade im Zusammenhang mit den sich häufenden Erinnerungsjahren stellt sich deshalb die Frage, in wie weit Adornos berühmte Formel einer „Erziehung nach Auschwitz“ und seine pädagogische Prämisse und Forderung, „dass Auschwitz nicht noch einmal sei“, heute noch von zentraler Bedeutung für Politische Bildung ist oder sein sollte. Diese Frage ist nicht zu trennen von aktuellen Forderungen, eine historisch-politische Bildung zu entwickeln, die auch den nachfolgenden Generationen und jungen Migranten/innen gerecht werden kann. Weitere aktuelle Herausforderungen für eine zeitgemäße „Politische Bildung nach Auschwitz“ sind der wachsende Rechtsextremismus und die Frage nach einer Europäisierung von Erinnerung. Siebzig Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz knüpft die non-formale Politische Bildung mit der Beteiligung an diesen Debatten an ihre normativ aufklärerischen Traditionen an. Der Band liefert einen wichtigen Beitrag zum Diskurs über Ziele, Aufgaben und Selbstverständnis der Politischen Bildung, der über die oft selbst gesetzten, engen Grenzen von schulischer Politikdidaktik und außerschulischer Politischer Bildung hinaus reicht und Erinnerungspädagogik als gemeinsame Aufgabe in den Blick nimmt. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Im vergangenen Jahr wurde in unzähligen Publikationen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 gedacht. In diesem Jahr erinnern wir uns an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Aber nicht nur diese beiden Gedenkjahre sondern auch die vielen aktuellen Gefahren für den Weltfrieden bieten Anlass, über die Bedeutung der Friedenspädagogik im Rahmen der politischen Bildung nachzudenken. Deshalb haben wir Harald Müller gebeten, eine grundlegende Einschätzung der Sicherheitslage 100Jahre nach dem Ersten Weltkrieg vorzunehmen. Er gelangt in seiner Analyse zu erstaunlichen Ähnlichkeiten zwischen der weltpolitischen Lage von 1914 und 2015. Hans-Joachim Reeb erläutert, weshalb Sicherheit ein zentraler Gegenstand der politischen Bildung sein sollte. Die Bilanz,die Klaus-Peter Hufer nach 30 Jahren Friedensbewegung und Friedenpädagogik zieht, gibt eher Anlass zur Beunruhigung. Umso erfreulicher ist der Einblick in ihre lebendige friedenspädagogische Arbeit,den uns Christof Starke und Markus Wutzler vom Friedenskreis Halle e.V. gewähren. Schließlich beschäftigen sich Dirk Lange und Moritz Peter Haarmann mit dem nicht unproblematischen Einsatz von Jugendoffizieren der Bundeswehr in allgemeinbildenden Schulen. Soldaten seien keine politischen Bildner, und die Bundeswehr habe keinen politischen Bildungsauftrag, lautet ihr eindeutiges Resümee.