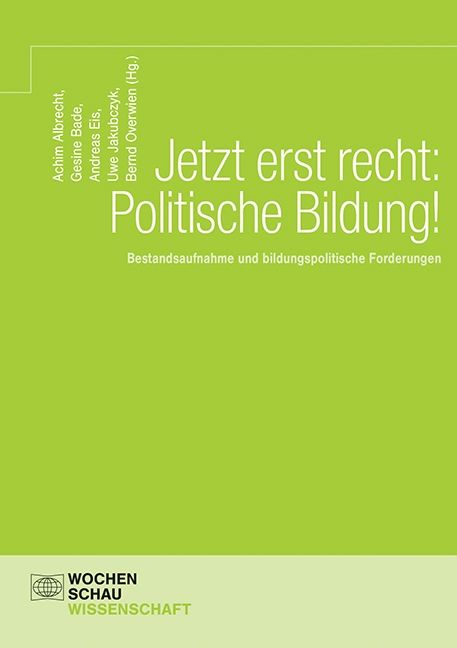Politische Bildung: vielfältig - kontrovers - global
Festschrift für Bernd Overwien
- herausgegeben von
- Gesine Bade, Nicholas Henkel, Bernd Reef
- unter Mitarbeit von
- Sabine Achour, Gesine Bade, Anja Besand, Inka Bormann, Hans-Jürgen Burchardt, Ellen Christoforatou, Andreas Eis, Oliver Emde, Susann Gessner, Thomas Gill, Edith Glaser, Nicholas Henkel, Gregor Lang-Wojtasik, Claudia Lohrenscheit, Bettina Lösch, Bernd Overwien, Stefan Peters, Bernd Reef, Marco Rieckmann, Laura Rivera Revelo, Christoph Scherrer, Sophie Schmitt, Benedikt Widmaier
Was sind die Prämissen und Ziele globalen Lernens? Wo und wie lassen sie sich mit politischer Bildung zusammendenken? Was kann, darf und will Kritische politische Bildung? Dieser Band sucht Antworten auf diese und andere Fragen und versammelt dabei Beiträge von Didaktiker*innen und (außerschulischen) Praktiker*innen der politischen Bildung, Erziehungswissenschaftler*innen und Sozialwissenschaftler*innen. Aus der Perspektive ihrer Fachdisziplinen reflektieren sie Ansätze politischer Bildung, Globalen Lernens und Kritischer politischer Bildung und entwickeln sie mit Blick auf aktuelle politisch…
| Bestellnummer: | 41145 |
|---|---|
| EAN: | 9783734411458 |
| ISBN: | 978-3-7344-1145-8 |
| Reihe: | Wochenschau Academy |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Seitenzahl: | 336 |
- Beschreibung Was sind die Prämissen und Ziele globalen Lernens? Wo und wie lassen sie sich mit politischer Bildung zusammendenken? Was ka… Mehr
- Inhaltsübersicht Gesine Bade, Nicholas Henkel, Bernd Reef Einleitung Gesine Bade, Nicholas Henkel, Bernd Reef Interview mit Bernd Overwien Sa… Mehr
- Autor*innen Prof. Dr. Sabine Achour ist Professorin für Politikdidaktik und Politische Bildung an der Freien Universität Berlin. Gesine… Mehr
Was sind die Prämissen und Ziele globalen Lernens? Wo und wie lassen sie sich mit politischer Bildung zusammendenken? Was kann, darf und will Kritische politische Bildung? Dieser Band sucht Antworten auf diese und andere Fragen und versammelt dabei Beiträge von Didaktiker*innen und (außerschulischen) Praktiker*innen der politischen Bildung, Erziehungswissenschaftler*innen und Sozialwissenschaftler*innen. Aus der Perspektive ihrer Fachdisziplinen reflektieren sie Ansätze politischer Bildung, Globalen Lernens und Kritischer politischer Bildung und entwickeln sie mit Blick auf aktuelle politische, ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen weiter.
Gesine Bade, Nicholas Henkel, Bernd Reef
Einleitung
Gesine Bade, Nicholas Henkel, Bernd Reef
Interview mit Bernd Overwien
Sabine Achour, Thomas Gill
Back to the Roots: Politisches Handeln nicht nur als Ziel, sondern als Weg
Gesine Bade
Was hat mein Smartphone mit dem Kongo zu tun?
Anja Besand
Kollateral-Lernen in der politischen Bildung
Inka Bormann, Marco Rieckmann
Lernende Hochschulen: Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung
Hans-Jürgen Burchardt
Back to school: Die Zukunft des Postkolonialismus
Ellen Christoforatou, Edith Glaser
Bildungsreisen als politisch-pädagogisches Programm:
Vom Austausch zur systematischen Integration
Andreas Eis
„Politische Pflanzen“ verschieben die Grenzen der gemeinsamen Welt und die Aufgaben politischer Bildung
Oliver Emde
Über die Gestaltungsmerkmale von außerschulischen Lernorten des Politischen
Susann Gessner
Überlegungen zum Verhältnis von Emotionen und politischer Bildung
Nicholas Henkel
Lehren und Lernen zwischen Populismus und Migration.
Politische Bildung und Globales Lernen in der dritten Phase der Lehrer*innenbildung
Gregor Lang-Wojtasik
Bildung für Nachhaltigkeit und/oder nachhaltiges Lernen?
Erziehungswissenschaftliche Überlegungen für Global Citizenship Education
Claudia Lohrenscheit
Menschenrechte verteidigen: Perspektivwechsel für Solidarität und Inklusion
Bettina Lösch
Politische Bildung und demokratische Gesellschaft:
Gemeinnützigkeit, Neutralitätsforderungen und Unabhängigkeit
Bernd Overwien
Bildung für nachhaltige Entwicklung und politische Bildung
Stefan Peters, Laura Rivera Revelo
Politische Bildung in Lateinamerika:
Möglichkeiten und Grenzen der politischen Bildung am Beispiel des kolumbianischen Friedensprozesses
Bernd Reef
Fragen an die Kritische politische Bildung
Christoph Scherrer
Das Global Labour-University-Netzwerk:
Ein neues Lernlabor für die internationale Arbeiter*innen-Solidarität?
Sophie Schmitt
Politische Bildung in Zeiten autoritärer Entwicklungen – Einhegungen und Einsprüche
Benedikt Widmaier
„Freie Träger“ brauchen demokratische Freiheiten!
Prof. Dr. Sabine Achour
ist Professorin für Politikdidaktik und Politische Bildung an der Freien Universität Berlin.
Gesine Bade
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung, in dem sie promoviert.
Prof. Dr. Anja Besand
ist Professorin für Didaktik der Politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden.
Prof. Dr. Inka Bormann
ist Professorin für den Arbeitsbereich Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt
ist Leiter des Fachgebiets Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen an der Universität Kassel.
Dr. Ellen Christoforatou
ist Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung an der Universität Kassel.
Prof. Dr. Andreas Eis
ist Leiter des Fachgebiets Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Kassel.
Oliver Emde
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim und dort im Bereich der politischen Bildung tätig.
Dr. Susann Gessner
ist Studienrätin im Hochschuldienst an der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit 2018 vertritt sie die Professur für Didaktik der Politischen Bildung an der Philipps-Universität Marburg.
Thomas Gill
ist Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Berlin.
Prof. Dr. Edith Glaser
ist Leiterin des Fachgebiets Historische Bildungsforschung an der Universität Kassel.
Nicholas Henkel
war Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Kassel und ist nun Mitarbeiter im Fachgebiet Vergleichende Politikwissenschaft (ebenfalls Universität Kassel), in dem er promoviert.
Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik
ist Professor für Erziehungswissenschaft und Pädagogik der Differenz an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit
ist Professorin für Internationale Soziale Arbeit und Menschenrechte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg.
PD Dr. Bettina Lösch
ist Akademische Rätin des Lehr- und Forschungsbereichs Politikwissenschaft, Bildungspolitik und politische Bildung an der Universität Köln.
Prof. Dr. Bernd Overwien
leitete von 2008–2019 das Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Kassel.
Prof. Dr. Stefan Peters
leitet die Professur für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
PD Dr. Bernd Reef
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Kassel.
Prof. Dr. Marco Rieckmann
ist Professor für Hochschuldidaktik mit dem Schwerpunkt Schlüsselkompetenzen an der Universität Vechta.
Laura Rivera Revelo
ist Juristin und Soziologin an der Universidad de Nariño (Kolumbien) und Promovendin an der Universidad Andina Simón Bolívar in Quito (Ecuador).
Prof. Dr. Christoph Scherrer
leitet das Fachgebiet Globalization and Politics (Globalisierung und Politik) an der Universität Kassel.
Prof. Dr. Sophie Schmitt
ist Professorin für die Didaktik der Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Benedikt Widmaier
ist Direktor des Hauses am Maiberg – Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz.
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Politische Fähigkeiten und demokratische Haltungen zu entwickeln, sind Bildungsziele aller Schulformen. Die Wirklichkeit widerspricht vielfach diesen Zielen. Aktuelle Daten zeigen, dass Politischer Bildung nur eine geringe Bedeutung in der Schule zukommt und dass sie häufiger als jedes andere Fach fachfremd unterrichtet wird. Den Herausgeber*innen dieses Sammelbandes geht es darum, die längst überfällige Debatte über die dringend notwendige Stärkung Politischer Bildung anzustoßen. Die Empfehlungen in diesem Band wurden von ca. 100 Expert*innen erarbeitet und richten sich an bildungspolitische Akteure in den Landtagen, an Fachverbände, Gewerkschaften sowie an Universitäten, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen.
Wochenschau Academy
Diese Dissertationsschrift liefert eine tiefgreifende und transdisziplinäre Untersuchung über ein wichtiges, aber unterbeleuchtetes Thema: die Wahrnehmungen muslimischer Jugendlicher zum Judentum und zu Jüd:innen. Neben einer ausführlichen Erörterung der Bedeutung des Islamischen Religionsunterrichts und des Identitätsfindungsprozesses muslimischer Jugendlicher enthält das Werk eine konzise Behandlung der jüdisch-muslimischen Beziehungen. Den Hauptteil bildet schließlich eine umfangreiche empirische Erhebung sowie deren ausführliche Auswertung und Diskussion. Das Buch schließt mit Thesen zu u…
Welche Perspektive haben Schüler*innen mit Fluchterfahrung auf gesellschaftliche Probleme und wie können diese im Rahmen politischer Bildung mit den Jugendlichen bearbeitet werden? Die qualitative Interviewstudie erarbeitet eine Grounded Theory des ‚Deutens‘ auf Basis der Kategorien des Problembewusstseins und Veränderungsmöglichkeiten. Damit ist die Arbeit anschlussfähig an bekannte Konzepte wie eine radikal demokratische Politikdidaktik, eine Kultur der Anerkennung und konzeptionelles Deutungswissen. Darüber hinaus liefert sie praktische Impulse zur Reflexion des Verhältnisses zwischen fachdidaktischen Anforderungen an Politikbegriffe und dem Politikverständnis der Jugendlichen.
Der 50. Geburtstag des Jugendzentrums in Selbstverwaltung Friedrich Dürr in Mannheim wird zum Anlass genommen, um Einblick in die vielfältige Praxis selbstorganisierter politischer Jugend(bildungs)arbeit zu erhalten. Autor- und Künstler:innen sind zumeist ehemalige und aktuelle Aktive des JUZ. Neben der solidarischen Würdigung des Engagements der JUZ-Aktiven ist es Anspruch und Ziel des Bandes, den historischen Konfliktlinien nachzuspüren und aktuelle Herausforderungen aufzuzeigen. Die Texte und Bilder reflektieren dabei zugleich kritisch das pädagogische Konzept wie die politische Praxis im Jugendzentrum. Klar wird: Selbstverwaltung ist keine Denkmalpflege.
Partizipationsbereite Bürgerinnen und Bürger, die zum Beispiel wählen gehen oder sich an politischen Diskussionen beteiligen, sind zentral für die Demokratie. Aber lässt sich diese politische Partizipationsbereitschaft bei Schülerinnen und Schülern im Politikunterricht steigern, indem das Internet eingesetzt wird? Und erfolgt eine Steigerung über ihr erhöhtes politisches Kompetenzgefühl? Diese Fragen werden hier mit Hilfe eines Quasi-Experimentes empirisch fundiert beantwortet und anschließend auf den Wirtschaftsunterricht übertragen. Die Erkenntnisse der Arbeit sind ein wichtiger Beitrag zur Forschung in der Politik- und Wirtschaftsdidaktik sowie für die Unterrichtspraxis in diesen Fächern.
Die vorliegende Studie setzt sich mit dem Postulat eines vermeintlichen „Neutralitätsgebotes“ in der politischen Bildung freier Träger der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit auseinander. In der Rekonstruktion aktueller Neutralitätsverhandlungen sowie in der Auswertung parlamentarischer Anfragen der AfD, welche Neutralitätspostulate formulieren, zeigt sich, dass diese Debatten weniger als bildungstheoretische Auseinandersetzungen zu werten sind. Vielmehr formulieren sie ein verkürztes, affirmatives Verständnis von Jugend(bildungs)arbeit und erweisen sich in der Konstruktion eines Linksextre…
Angesichts von (Re-)Nationalisierungsprozessen in der Gesellschaft erscheint eine kritische politische Bildung wichtiger denn je. Das Feld der Internationalen Jugendarbeit kann hierbei besondere Lernmomente bieten, in denen die Teilnehmenden sich und ihre Perspektiven reflektieren und erweitern und so eine Vorstellung von sich als Weltenbürger*innen ergründen können. Doch wer nimmt Teil am „Blick über den Tellerrand“? Und mit welchen Erfahrungen und neuen Selbstverständnissen kommen die Jugendlichen zurück? Basierend auf qualitativen Interviews und einer intersektionalen Mehrebenenanalyse wird das Feld anhand ausgewählter diversitätsbewusster Projekte aus dem Bereich der internationalen Jugendbegegnungen sowohl aus Sicht der Teilnehmer*innen als auch aus Sicht der Teamer*innen beleuchtet. Hierbei werden Projekte fokussiert, die sich bewusst an Jugendliche wenden, die sich aus Sicht formalisierter Bildung eher als „Bildungsbenachteiligte“ beschreiben lassen. Diese sind auch nach jahrelangen Versuchen, das Stigma von teuren Projekten für privilegierte Jugendliche zu überwinden, noch immer marginalisiert in der Internationalen Jugendarbeit zu finden, obwohl das Interesse an den Projekten milieuunabhängig vorhanden ist. Ulrike Becker zeigt in ihrem Band, welche Chancen differenzsensible Projekte bieten und vor welchen Herausforderungen sie dennoch stehen. Damit eröffnet sie neue Erkenntnisse für das Feld einer diversitätsbewussten Internationalen Jugendarbeit.
Was sind die Prämissen und Ziele globalen Lernens? Wo und wie lassen sie sich mit politischer Bildung zusammendenken? Was kann, darf und will Kritische politische Bildung? Dieser Band sucht Antworten auf diese und andere Fragen und versammelt dabei Beiträge von Didaktiker*innen und (außerschulischen) Praktiker*innen der politischen Bildung, Erziehungswissenschaftler*innen und Sozialwissenschaftler*innen. Aus der Perspektive ihrer Fachdisziplinen reflektieren sie Ansätze politischer Bildung, Globalen Lernens und Kritischer politischer Bildung und entwickeln sie mit Blick auf aktuelle politische, ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen weiter.
Samuel Essler geht das Thema menschliche Entwicklung in dieser interdisziplinären Arbeit mithilfe des Vergleichs zweier Theorien an, die unter anderem Antwort auf die Frage nach den Kriterien eines gelungenen Lebens geben.
Kompetenzen sind zu zentralen Kategorien der schulischen Politischen Bildung geworden. Leisten sie einen Beitrag zur „politischen Mündigkeit“? Wächst mit ihnen die Qualität des Politikunterrichts? Die vorliegende Arbeit legt kritische, empirisch basierte Studien der durch die Kompetenzorientierung entstandenen Veränderung des Unterrichtsfachs vor.
Wie orientieren sich Jugendliche angesichts des Wandels von Arbeit und welche Bedeutung hat dies für politische Lern- und Bildungsprozesse? Die qualitativ-rekonstruktive Studie bietet einen Einblick in das Verhältnis von Jugend, Arbeit und Identität. Die Autorin plädiert für eine gesellschaftswissenschaftlich orientierte politische Bildung, welche den Orientierungsbedarf Jugendlicher hinsichtlich Arbeit berücksichtigt.
Aktuelle Themen wie die Digitalisierung und der zunehmende Rechtspopulismus fordern die Politische Bildung als Profession heraus. Die Beiträge der Festschrift sollen als Momentaufnahmen dazu einladen, die Profession politischer Bildung weiterzuentwickeln und einen aktuellen Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
Was hat politische Bildung überhaupt mit Körperlichkeit zu tun? Diese politikdidaktische Untersuchung beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle der Körper hinsichtlich der Darstellung und Wahrnehmung des Politischen spielt und welche Implikationen sich daraus für politische Bildungsprozesse ergeben. Die Rezeption der pragmatischen Philosophie der Somästhetik (Richard Shusterman) dient als Heuristik, um somästhetische Perspektiven im Kontext verschiedener Handlungsfelder politischer Bildung herauszuarbeiten.
Angesichts des demografischen Wandels wird die Pflege von Menschen mit Demenz als zunehmende gesellschaftliche Herausforderung für familiäre und öffentliche Versorgungssysteme angesehen. In diesem Zusammenhang werden auch freiwillig Engagierte zu wichtigen Akteuren in der häuslichen Versorgung von Menschen mit Demenz. Basierend auf qualitativen Interviews wird das Feld der häuslichen Versorgung bei Demenz in dieser Studie aus der Perspektive freiwillig Engagierter erschlossen und anhand gesellschaftlicher Diskurse zum Thema gerahmt. Ausgehend von der Freiwilligenperspektive eröffnet sich eine, auf Beziehung fokussierte, Koproduktionskonstellation im Feld häuslicher Demenzversorgung.