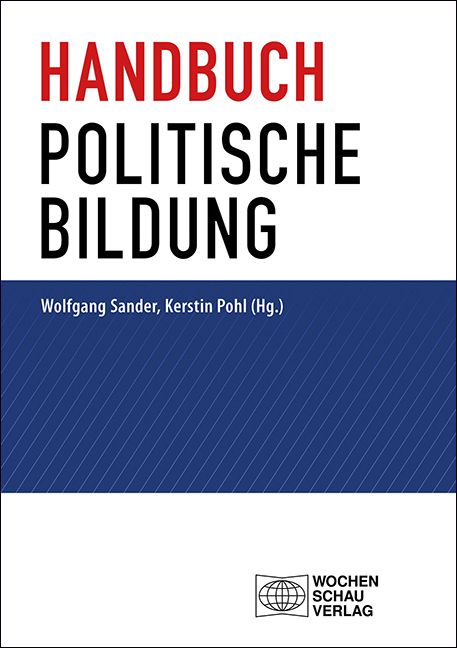Zu "Sabine Achour" wurden 47 Titel gefunden
Was bringt uns als Menschen in der Demokratie und in globalen Zusammenhängen eigentlich „unser gutes Recht“ für die Lösung von (zunehmend herausforderungsvollen) Zukunftsfragen? Welchen Beitrag leistet das Recht, wenn es um unsere Freiheiten, unsere Sicherheit und ökologischen Lebensgrundlagen geht? Klimakrise, die Ursachen und Folgen von Flucht und Migration, Kriegsverbrechen, globale Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen sowie die Schattenseiten der Digitalisierung stellen Schlüsselprobleme dar, die über den Nationalstaat hinausgehende politische Lösungen erfordern. Die Instrumente von Politik und Demokratien dafür sind insbesondere Recht und Rechtsstaat. Das bedeutungsvolle Zusammenspiel von Politik, Recht und Rechtsstaat ist Thema dieser Ausgabe von POLITIKUM. Sie ist in Kooperation mit der Stiftung Forum Recht entstanden, die zu einer breiteren Kommunikation über Recht und Rechtsstaat mit der Öffentlichkeit einladen möchte. Ein Interview mit Dr. Yvonne Ott, Bundesverfassungsrichterin und Kuratoriumsmitglied der Stiftung, leitet das Heft ein. Sie illustriert, inwiefern Recht und Rechtsstaat nicht nur als „Problemlöser“ fungieren, sondern auch Partizipation, Teilhabe und Mitgestaltung von Recht und Politik möglich machen. Die weiteren Beiträge widmen sich den oben genannten Schlüsselproblemen und wurden in Teilen von Mitgliedern des Stiftungsbeirates verfasst: Bleibt Gerechtigkeit angesichts der Völkerrechtsverbrechen in der Ukraine eine Utopie? Lässt sich Massenmigration menschenrechtskonform steuern? Warum brauchen wir ein umfassendes Antidiskriminierungsrecht? Wie gehen wir mit Datafizierung als Herausforderung für den Rechtsstaat um? Inwiefern ist ziviler Ungehorsam ein Motor des Rechtsstaats? Und: Hat die Natur Rechte? Die jeweiligen Beiträge gehen über bloße Diagnosen hinaus. Sie versuchen Ursachen und Grenzen zu analysieren sowie Richtungen für Recht und Rechtsstaat aufzuzeigen, wie diese für uns als Gesellschaft bei der Bewältigung der genannten Herausforderungen als effektive Instrumente fungieren können.
Das Basisheft nimmt die Bereiche Jugend, Familie und Gesellschaft sowie deren Verbindungen und Reibungspunkte in den Blick. Um nur einige Aspekte zu nennen: Wie bin ich als Jugendliche*r in verschiedenen Räumen und welche Erwartungen werden dort an mich gestellt? Welche Familienkonstellationen gibt es und was bedingen sie? Wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Familie?
Die in "Diversität und Demokratie" versammelten Beiträge fokussieren die Zukunft der sprachlichen und politischen Bildung im Lichte gesellschaftlicher Vielfalt aus interdisziplinärer Perspektive. Sie thematisieren die Rolle der Sprache in der politischen und des Politischen in der sprachlichen Bildung und damit die Verknüpfung von edukativen Praktiken, politischen Diskursen und Sprachhandeln. Angesichts sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen - etwa in Hinblick auf Dynamiken sozialer, kultureller und sprachlicher Diversifikation, Digitalisierungsprozesse wie auch Prävention und Bewältigung vo…
Das Basisheft für die Sekundarstufe II gibt einen umfassenden Einblick in Institutionen, Kompetenzen und politische Prozesse der Europäischen Union. Das Themenheft beginnt mit einer Einordnung der Einstellungen gegenüber der EU, die in den letzten zwei Jahrzehnten stark schwankten. Einem problemorientierten Einblick in die Geschichte des europäischen Integrationsprozesses folgt eine vertiefende Behandlung des politischen Prozesses im Mehrebenensystem der EU sowie eine Analyse aktueller Herausforderungen wie Korruption, Krieg in Europa und Nationalisierungstendenzen in einzelnen EU-Staaten. Abschließend wird das Regierungssystem der EU mit ihren möglichen demokratischen Defiziten kritisch beleuchtet.
Die Schüler*innen lernen anhand aktueller Fallbeispiele problemorientiert die Herausforderungen, Handlungsfelder, Instrumentarien und Akteur*innen in der Außenpolitik kennen. Außenpolitik umfasst alle Aktivitäten staatlicher Organe, die die Beziehungen zu anderen Staaten, Regionen und internationalen Organisationen betreffen. Auf dieser Grundlage diskutieren sie die Ziele und die Ausrichtung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Das Vertiefungsheft greift eine Bandbreite an Themen auf: von Zeitenwende und der 50-jährigen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen bis Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in China werden aktuelle Problemstellungen der internationalen Beziehungen aus Sicht der deutschen Außenpolitik kritisch beleuchtet. Das Themenheft für den Politik- und Sozialkundeunterricht der Sekundarstufe I schließt ab mit einem handlungsorientieren Zugang zum zukunftsträchtigen Trend Klima-Außenpolitik.
Freiheit ist ein schillernder Begriff unserer demokratischen Ideengeschichte. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde der Begriff unter der Frage diskutiert, ob Eingriffe in unsere Freiheitsrechte legitim sind. Aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine scheint sich das Spannungsverhältnis Freiheit vs. Sicherheit neu zu öffnen. Dieses WOCHENSCHAU-Vertiefungsheft nimmt die aktuellen Kontoversen rund um den Freiheitsbegriff auf und verbindet sie mit Gerechtigkeitsfragen in Bezug auf Gleichheit. Es werden zwei Grundbegriffe der modernen Demokratie problemorientiert und fallbezogen diskutiert, beispielsweise anhand der Regulierung von sozialen Medien oder der Verteilung von Armut und Wohlstand auf der Welt.
Mit den Landtagswahlen 2023 vor der Tür richtet sich das WOCHENSCHAU-Zusatzheft„Landtagswahlen Hessen“ an Schüler*innen, insbesondere im wahlfähigen Alter. Hier erfahren Schüler*innen der Sekundarstufe II, wie sie zu einer Wahlentscheidung kommen können, warum Länder Parlamente haben und wie eine Wahl eigentlich abläuft. Sie finden eine Anleitung zur Wahl im Wahllokal oder per Brief, lesen ein Interview zum Wahl-O-Mat und beschäftigen sich zum Schluss kritisch mit den demokratischen Eigenschaften einer Wahl. Das Themenheft „Landtagswahl Hessen“ ist mehr als ein Informationsflyer. Es enthält ein Arbeitsblatt zu „Was darf der Landtag eigentlich entscheiden?“, aber auch Material zur kritischen Prüfung, wer überhaupt an Landtagswahlen teilnehmen darf. So können Schüler*innen ihr eigenes Wissen zu diesen Themen prüfen und angeleitet vom Material die Teilhabemöglichkeiten in Ihrem Bundesland hinterfragen. Praktische Informationen zum Ablauf eines Gangs zur Urne oder der Briefwahl sollen den Erstwähler*innen die Angst vor „Fehlern“ nehmen und die Bereitschaft zur Teilnahme an der Wahl erhöhen. Zum Schluss können Schüler*innen auch Koalitionsverhandlungen simulieren und dabei herausfinden, wie Verhandlungsprozesse in der Politik funktionieren und welche Herausforderungen mit diesen verbunden sind.
Partizipation in der Demokratie basiert auf Grundlagen, die zugleich Ziel und Selbstverständnis politischer Bildung sind: Subjektorientierung, freie Urteilsbildung, Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Indoktrinationsverbot, Konflikt- und Kontroversitätsorientierung. Sie bedarf aber auch einer demokratisch gesinnten Bevölkerung, die durch ihre Partizipation Demokratie mitgestaltet, weiterentwickelt und für sie einsteht.Was bedeutet es angesichts dieser gegenseitigen Angewiesenheit für die politische Bildung, wenn sich die Formen demokratischer Herrschaft in einem rasanten Wandel befinden?Der Band beleuchtet eine Vielzahl von Entwicklungen der letzten Jahren, die einerseits unsere Demokratie verändern, andererseits aber auch neue Formen von Beteiligung hervorbringen. Herausgekommen ist eine Standortbestimmung der politischen Bildung, die den Auftrag, alle Menschen mitzunehmen und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, ernst nimmt.
Mit der WOCHENSCHAU „In unserer Gesellschaft leben“ erschließen sich Schüler*innen der Sekundarstufe I die Teilhabemöglichkeiten in ihrem gesellschaftlichen und politischen Umfeld mit einem empowernden Zugang. Wie können wir gemeinsam Gesellschaft gestalten? Welche Erfahrungen machen dabei unterschiedliche Gruppen? Wie können wir die Hindernisse, die einige dabei haben, gemeinsam aus dem Weg räumen – von der Freizeit bis in den formellen Politikbereich? Das Einstiegskapitel thematisiert Selbstbezeichnungen von Gruppen, um so in den Folgekapiteln sensibel für die jeweiligen Perspektiven zu sein: es geht um die Teilhabe vielfältiger junger Menschen im Sport, ihre Des-/Integration im Übergang Schule-Beruf bis hin zu formellen politischen Partizipations(un)möglichkeiten am Bsp. Wahlrecht.
Was ist Sicherheitspolitik? Wie hat sie sich entwickelt? Welche Institutionen sind wichtig? Welche Haltung nehmen die verschiedenen Parteien ein? Diese und weitere Fragen werden im WOCHENSCHAU-Heft „Sicherheitspolitik in einer prekären Weltordnung“ behandelt. Dafür analysieren die Schüler*innen verschiedene Fallbeispiele hinsichtlich der zutage tretenden Sicherheitsverständnisse und beteiligten Akteure. Ziel ist eine Vorstellung davon zu entwickeln, wer die Welt wie ordnet bzw. ordnen will.
Der Frieden der letzten Jahrzehnte in Europa ist durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nicht mehr gegeben. Für viele Schüler*innen und Lehrkräfte ist diese Situation emotional belastend und aufwühlend. In dieser WOCHENSCHAU für die Sek. I wird bewusst ein friedenspädagogischer Ansatz verfolgt, um den Schüler*innen Möglichkeiten der Friedenssicherung aufzuzeigen und Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft zu geben. Ausgewählte Fallbeispiele machen die elementare Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationen für die Befriedung von Konflikten und Kriegen deutlich. Gleichzeitig erlernen die Schüler*innen Basiswissen rund um die Themen Sicherheitspolitik und Diplomatie.
Dieser Band bietet Studierenden eine differenzierte, verständliche und kompakte Einführung in die Themen und Teildisziplinen der Politikwissenschaft. Renommierte Autor*innen geben einen Überblick über zentrale Gegenstände, Fragestellungen und Methoden der wichtigsten Teilgebiete des Faches. Dabei werden Veränderungen, Themenkonjunkturen, Kontinuitäten und Brüche herausgearbeitet.
Das aktualisierte Vertiefungsheft nimmt die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Themen in der Europäischen Union in den Blick: Vor dem Hintergrund einer Szenario-Analyse werden die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Brexit betrachtet. Im zweiten Kapitel steht das Thema Migrationsbewegungen im Fokus. Nach der Darstellung des rechtlichen Rahmens folgt eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Diskussion zu dem Thema in der EU, anhand derer die Schüler*innen die Folgen, die Verteilungsproblematik sowie die Frage nach der Handlungsfähigkeit der EU bearbeiten können. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU wird schließlich im dritten Kapitel angeregt, bevor es im letzten Kapitel um die Frage nach der Energie- und Klimapolitik der EU und den damit verbundenen ökonomischen und sozialen Folgen geht.
Dieses Themenheft nimmt die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Gesellschaftslehre/GeWi auf und bietet den Schüler*innen der Sekundarstufe I einen multiperspektivischen Blick auf das Themenfeld Ernährung. Die Bezugswissenschaften Politik, Geographie und Geschichte werden in diesem Heft spielerisch und altersgerecht vereint. Für dieses Heft lohnt es sich, einen Blick in den Onlinebereich der WOCHENSCHAU zu werfen, da Sie dort Ergänzungen und Erläuterungen zum Heft finden, die Ihren Unterricht bereichern können.
Mag die Behauptung auch pauschal anmuten, so ist es „rechtem Denken“ doch gelungen, in fast alle staatlichen Institutionen vorzudringen. Bedeutung, Rolle und Verbreitungsmöglichkeiten des Rechtsextremismus hängen nicht zuletzt davon ab, ob und wie Institutionen auf rechte und rechtsextreme Organisationen, Ideologien und Gewalttaten reagieren. Je weniger rechtes Denken und Handeln demaskiert und diesem in Institutionen entgegengetreten wird, desto umfassender dessen Legitimierung, desto schwieriger dessen (verwaltungs)praktische und juristische Ahndung. Hat Ignoranz gegenüber bekannten rechten Strukturen und rechten Diskursverschiebungen in der Gesellschaft auch diejenigen Institutionen erfasst, die dem Staat und damit dem Wohl aller dienen sollen – ohne Ansehen der Person? Institutionelles Agieren mit Blick auf die Mordserie des NSU, nach den Morden in Hanau oder dem an Oury Jalloh sind nur wenige Beispiele, die Zweifel an diesem Grundsatz säen. Dies ist kein Thema wie jedes andere. Denn es geht um die Institutionen und ihre Funktionsträger*innen, deren zentrale Aufgabe darin besteht, den demokratischen Rechtsstaat und die Menschen zu schützen, die hier leben. Die Grundlage dieses Heftes bildet ein Beitrag, der im Bezug auf den Begriff Rechtsextremismus terminologische Aufräumarbeit leistet. Er klärt, wie die unterschiedlichen Begriffe verschiedene Phänomene erfassen, um zu einer Differenzierung der allgemein beschriebenen Gefahr von rechts beizutragen. Welchen Einfluss hat der Einzug der AfD in alle Landesparlamente und den Bundestag sowie ihre stetige Radikalisierung? Wie steht es um die demokratische Verfasstheit von Polizei, Justiz, Bundeswehr und Verfassungsschutz? Diese Fragen will das vorliegende Heft beantworten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Rechtsextremismus in Gewerkschaften sowie rechtem Denken in Universitäten und Hochschulen, aber auch mit Angriffen von rechts auf (politische) Bildung und Schule – Stichwort Desiderius-Erasmus-Stiftung und Institut für Staatspolitik. Welche Mechanismen lassen sich bestimmen, wenn Institutionen von Rechtsaußen unterwandert werden? Die jeweiligen Beiträge gehen über bloße Diagnosen hinaus. Sie versuchen die Ursachen zu analysieren, weisen darauf hin, dass das Ausmaß des Problems noch nicht ausreichend vermessen ist, schätzen die tatsächlichen Gefahren ein und zeigen Strategien auf, wie es den Institutionen gelingen kann, sich gegen diese Entwicklungen zur Wehr zu setzen und dabei die Demokratie zu schützen.
In diesem WOCHENSCHAU-Basisheft lernen die Schüler*innen der Sekundarstufe I den Sozialstaat kennen. Sie erwerben Kenntnisse über die unterschiedlichen Aufgabenfelder des Sozialstaates und lernen exemplarisch, wie der Sozialstaat in Deutschland aufgebaut ist. Zum Abschluss des Themenheftes setzen sich die Schüler*innen mit möglichen Zukünften des Sozialstaates auseinander.
Im Herbst 2020 hat die EU ihren ersten Rechtsstaatlichkeitsbericht vorgelegt und spricht Deutschland darin ein insgesamt gutes Urteil aus: Kritisiert wird das Weisungsrecht, dass die Justizminister*innen über Staatsanwält*innen haben. Aber die Unabhängigkeit der Richter*innen, Effizienz, Personalstärke und auch Digitalisierung seien positiv zu bewerten. Die WOCHENSCHAU Justiz kontrovers zieht weitere Analysen, Lageberichte und exemplarische Fallbeispiele heran und vertieft neben Grundlagenwissen auch obige Themen. Welche Rolle spielen Gerichte während der Corona-Pandemie und wie zeigt sich hier das Prinzip der Rechtsgüterabwägung? Wie kann die Qualität der Rechtsprechung bestehen bleiben, wenn Justizbehörden als Arbeitsplatz an Attraktivität verlieren? Wie sieht das Vertrauensverhältnis der Bürger*innen, insbesondere von Minderheiten, in die Justiz aus und welche Konsequenzen kann dies haben? Ist die Justiz auf dem rechten Auge blind? Die WOCHENSCHAU Justiz kontrovers richtet sich, gewohnt differenziert, problemorientiert und aktuell an Schüler*innen der Sekundarstufe II.
Wird Künstliche Intelligenz (KI) eines Tages die Welt regieren? Nicht erst seit der Science Fiction des 20. Jahrhunderts existiert in Film und Literatur das Motiv von intelligenten Robotern und Maschinen mit mannigfachen „Persönlichkeiten“. Anfangs vom Menschen für eine gute Sache entwickelt, wenden sie sich gegen ihn und wollen schließlich die Menschheit unterwerfen. Dieser Mythos lässt sich als Nachricht sogar in den Medien finden. Auch wenn heute keine KI in der Lage ist, mit gleichen intellektuellen Fertigkeiten wie der Mensch – oder höheren – zu denken, zu entscheiden oder ein selbst gestecktes Ziel zu erreichen (sog. starke KI), zeigen solche Mythen, dass KI für viele mit Ängsten und Verunsicherungen verbunden ist. Obwohl das Thema de facto ein Oldie ist und schon 1956 im Rahmen einer Konferenz am Dartmouth College thematisiert wurde, ist es zurzeit hochaktuell. Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft verändern. Sie polarisiert, je nachdem, welche Potentiale mit ihr eröffnet werden bzw. welche Risiken mit ihr einhergehen. Wie und in welchen Bereichen kann sie unser Leben konkret verbessern? Wo müssen Grenzen gesetzt und Regelungen getroffen werden? Solchen insbesondere gesellschaftswissenschaftlichen Fragen widmet sich diese Ausgabe von . Eine Klärung, was genau unter KI zu verstehen ist, illustriert zugleich die zentralen Herausforderungen hinsichtlich einer menschenrechtskonformen, diskriminierungs- und sexismusfreien Anwendung. Unter der Kontroverse „schöne neue Welt oder unsere Welt?“ werden verschiedene schon existierende Anwendungsgebiete, aber auch Grenzen von KI in Staat und Verwaltung, Gesundheitswesen und Arbeitswelt sowie notwendige Regelungen diskutiert. Besondere Befürchtungen gibt es gegenüber autonomen Waffensystemen, so dass man hier zurecht von einem „Stresstest für die internationale Sicherheitspolitik“ sprechen kann. Nicht zuletzt demaskierte die Covid-19-Pandemie erneut die zahlreichen Digitalisierungsdefizite im Bereich von Bildung und Schule. Können KI-Anwendungen bis hin zu humanoiden Robotern zu einer Reformierung beitragen? Wenn KI unsere Zukunft besser machen soll, muss sie vom Menschen her gedacht werden. Und dies liegt in unserer Hand, denn: „Hinter jeder Maschine steckt ein Mensch“ (Katharina Zweig).
Was sind die Prämissen und Ziele globalen Lernens? Wo und wie lassen sie sich mit politischer Bildung zusammendenken? Was kann, darf und will Kritische politische Bildung? Dieser Band sucht Antworten auf diese und andere Fragen und versammelt dabei Beiträge von Didaktiker*innen und (außerschulischen) Praktiker*innen der politischen Bildung, Erziehungswissenschaftler*innen und Sozialwissenschaftler*innen. Aus der Perspektive ihrer Fachdisziplinen reflektieren sie Ansätze politischer Bildung, Globalen Lernens und Kritischer politischer Bildung und entwickeln sie mit Blick auf aktuelle politische, ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen weiter.