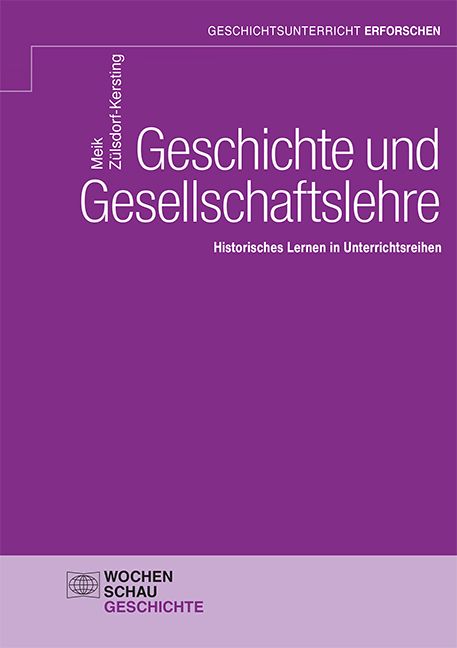Theorie des Geschichtsunterrichts
- von
- Sebastian Bracke, Colin Flaving, Johannes Jansen, Manuel Köster, Jennifer Lahmer-Gebauer, Simone Lankes, Christian Spieß, Holger Thünemann, Christoph Wilfert, Meik Zülsdorf-Kersting
Die vorliegende Monografie legt erstmals eine in sich geschlossene Theorie des Geschichtsunterrichts vor und schließt so eine Forschungslücke. Geschichtsunterricht wird hier als soziales System modelliert und damit in seiner Eigenlogik als soziales Geschehen ernstgenommen, das über kommunikative Prozesse die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins der Schüler*innen erreichen möchte. In diesem komplexen Zusammenhang kommt den Dimensionen des historischen Denkens, den Emotionen, der Kommunikation, den Medien und der Sprache eine besondere Bedeutung zu. Der Band integriert unterrichts- und geschi…
| Bestellnummer: | 40618 |
|---|---|
| EAN: | 9783734406188 |
| ISBN: | 978-3-7344-0618-8 |
| Format: | Broschur |
| Reihe: | Geschichtsunterricht erforschen |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Auflage: | 1. Aufl. |
| Seitenzahl: | 288 |
- Beschreibung Die vorliegende Monografie legt erstmals eine in sich geschlossene Theorie des Geschichtsunterrichts vor und schließt so ein… Mehr
- Inhaltsübersicht 1. Einleitung 2. Geschichtsunterricht als soziales System 2.1 Einleitung 2.2 Unterrichtstheorie – wissenschaftstheoretische… Mehr
- Autor*innen Sebastian Bracke, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Osnabrück (Didaktik der Geschic… Mehr
- Stimmen zum Buch „Die Stärke des Buchs liegt vor allem in der Übersicht über aktuelle Forschungserkenntnisse und –diskurse, die mit neuer Per… Mehr
1. Einleitung
2. Geschichtsunterricht als soziales System
2.1 Einleitung
2.2 Unterrichtstheorie – wissenschaftstheoretische Vorbemerkungen
2.3 Unterricht als soziales System
2.4 Geschichtsdidaktische Theorien des Geschichtsunterrichts – ein Überblick
2.5 Zwischen Kontingenz und Kontingenzbeschränkung – Theorie des Geschichtsunterrichts in systemtheoretischer Perspektive
2.5.1 Der Begriff „Geschichtsunterricht“
2.5.2 Strukturmodell des Geschichtsunterrichts
2.5.2.1 Historisches Denken
2.5.2.2 Emotionen im Geschichtsunterricht
2.5.2.3 Kommunikation im Geschichtsunterricht
2.5.2.4 Medien im Geschichtsunterricht
2.5.2.5 Sprache im Geschichtsunterricht
3. Historisches Denken lernen
3.1 Einleitung
3.2 Geschichtsdidaktische Traditionslinien und Modelle historischen Denkens
3.2.1 Angelsächsische Beiträge – Konzepte historischen Denkens
3.2.2 Geschichtsbewusstsein als Beitrag der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik
3.2.2.1 Geschichtsbewusstsein und historisches Denken I: Jeismann
3.2.2.2 Geschichtsbewusstsein und historisches Denken II: Rüsen
3.2.2.3 Geschichtsbewusstsein und historisches Denken III: Hasberg/Körber
3.2.2.4 Geschichtsbewusstsein und historisches Denken IV: Kompetenzmodelle historischen Denkens
3.3 Das HISTOGRAPH-Modell historischen Denkens – Versuch einer Synthese
3.3.1 Historische Fragen
3.3.2 Historische Sach(verhalts)analysen
3.3.3 Historische Sachurteile
3.3.4 Historische Werturteile
3.3.5 Historisches Denken und historisches Wissen . 100
3.3.6 Historisches Denken, historisches Lernen, historischer Kompetenzerwerb
4. Emotionen im Geschichtsunterricht
4.1 Einleitung
4.2 Emotionen in der geschichtsdidaktischen Diskussion
4.3 Theorie der Emotionen
4.3.1 Entstehung von Emotionen
4.3.2 Komponenten, Funktionen und Effekte von Emotionen
4.3.3 Regulation von Emotionen
4.4 Emotionen und (historisches) Lernen
4.4.1 Emotionen und Lernen
4.4.2 Emotionen und historisches Denken
4.5 Emotionen im sozialen System Geschichtsunterricht
4.6 Geschichtsunterricht aus emotionstheoretischer Perspektive
5. Kommunikation
5.1 Einleitung
5.2 Historisches Denken und Kommunikation
5.3 Reflektiert historisch denken lernen durch Kommunikation
5.4 Die Kommunikationsform Unterricht
5.4.1 Kommunikative Rollen im Unterricht
5.4.2 Kernstruktur der Unterrichtskommunikation: IRE-Sequenzen
5.4.3 Die Organisation des Sprecherwechsels
5.5 Verständigung über Geschichte in der Kommunikationsform Unterricht
6. Medien im Geschichtsunterricht
6.1 Einleitung
6.2 Quellen und Darstellungen als Verbreitungsmedien im sozialen System Geschichtsunterricht
6.2.1 Bedeutung von Quellen und Darstellungen für den Geschichtsunterricht aus geschichtsdidaktischer Perspektive
6.2.2 Umgang mit Quellen und Darstellungen in einem auf fachspezifische Pädagogizität ausgerichteten Geschichtsunterricht
6.2.3 Folgen für die Kommunikation im sozialen System Geschichtsunterricht
6.3 Medien im Geschichtsunterricht aus systemtheoretischer Perspektive
6.3.1 Das Universalmedium Sinn
6.3.2 Kommunikationsmedien
6.3.2.1 Sprache
6.3.2.2 Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien
6.4 Fazit
7. Sprache
7.1 Sprache im System Geschichtsunterricht
7.2 Dimension 1: sprachliche Register
7.2.1 Alltagssprache
7.2.2 Bildungssprache und Fachsprache(n)
7.2.3 Pädagogische Sprache
7.3 Dimension 2: Die Sprachen des Geschichtsunterrichts
7.3.1 Die Sprachen der Unterrichtsgegenstände
7.3.1.1 Die Sprache der Quellen
7.3.1.2 Die Sprache historischer Darstellungen
7.3.2 Die Sprachen des Unterrichtsdiskurses
7.3.2.1 Schüler*innensprache
7.3.2.2 Lehrer*innensprache
7.4 Zusammenfassung
8. Fazit: Perspektiven und Potenziale einer kontingenzgewärtigen Theorie des Geschichtsunterrichts
9. Literatur
Autor*innenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Sebastian Bracke, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Osnabrück (Didaktik der Geschichte). Geschichtsunterricht und historisches Denken sind Schwerpunkte seiner Forschung.
Colin Flaving ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Didaktik der Geschichte der Universität zu Köln. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der geschichtsdidaktischen Unterrichtsforschung.
Johannes Jansen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Didaktik der Geschichte sowie Koordinator des Interdisziplinären Forschungszentrums für Didaktiken der Geisteswissenschaften der Universität zu Köln. Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Geschichtsunterrichtsforschung, Historiografie/Narratologie und Schulbuchforschung.
Dr. Manuel Köster ist nach Studium, Promotion und Lehrtätigkeit in Münster seit 2014 Akademischer Rat an der Universität zu Köln. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sprache und Geschichte, geschichtsdidaktische Lehr-Lern-Forschung, Unterrichtsforschung und Geschichtskultur.
Jennifer Lahmer-Gebauer ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Osnabrück (Didaktik der Geschichte). Zuvor arbeitete sie für das Entwicklungsprojekt „Research Collaborative Bibliography of History Education“. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Lehrer*innenprofessionsforschung.
Simone Lankes ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte an der Universität zu Köln. Sie forscht in den Bereichen historisches Lernen und Inklusion sowie geschichtsdidaktische Diagnostik.
Dr. Christian SpieSS studierte die Fächer Geschichte und Englisch (gymnasiales Lehramt) an der Georg-August-Universität in Göttingen. Im Anschluss an das Erste Staatsexamen promovierte er im DFG-Graduiertenkolleg 1195 „Passungsverhältnisse schulischen Lernen“ und absolvierte sein Referendariat am Studienseminar Oldenburg. Nach Lehrtätigkeiten in Frankfurt/M.(Erziehungswissenschaften) und Osnabrück (Didaktik der Geschichte) unterrichtet er seit August 2017 an der IGS List in Hannover.
Dr. Holger Thünemann , ist nach Referendariat, Schuldienst und beruflichen Stationen an der Universität Münster und der PH Freiburg seit 2013 Professor für Didaktik der Geschichte an der Universität zu Köln; zahlreiche Veröffentlichungen zu Themen der Geschichtskultur, der geschichtsdidaktischen Schulbuchforschung und der historischen Lehr-Lernforschung.
Christoph Wilfert ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrkraft für besondere Aufgaben am Historischen Institut der Universität zu Köln (Abteilung für Didaktik der Geschichte). Zuvor arbeitete er als Lehrer für die Fächer Geschichte und Sport an einem Bonner Gymnasium. Seine Forschungsschwerpunkte liegen neben der geschichtsdidaktischen Unterrichtsforschung im Bereich der fachspezifischen Lehrerbildungs- und Schulbuchforschung.
Dr. Meik Zülsdorf-Kersting, Professor für Didaktik der Geschichte am Historischen Seminar der Universität Osnabrück; Veröffentlichungen zu Themen des historischen Denkens, der Geschichtsunterrichtsforschung sowie der Geschichtskultur.
„Die Stärke des Buchs liegt vor allem in der Übersicht über aktuelle Forschungserkenntnisse und –diskurse, die mit neuer Perspektive betrachtet werden, sowie in den davon ausgehenden Impulsen für Diskussionen und weitere geschichtsdidaktische Forschungsarbeiten. (...) Zweifellos ein wichtiges Buch für die geschichtsdidaktische Diskussion.“
Wolfgang Buchberger, Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 2021 (20. Jg.)
„Insgesamt ist den Verfassern/-innen mit der vorliegenden Monografie etwas Beachtliches gelungen. Jedes der einzelnen Kapitel zeichnet sich durch einen starken, weit über die deutschsprachige Geschichtsdidaktik hinausgehenden Forschungsbezug aus, jedes für sich bietet Anregungen zum Nachdenken.“
Barbara Hanke, zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften 2/2019
„Als Reflexionsinstanz sei diese beeindruckende Theorie allen Fachleiter/innen sowie den Lehrenden der Geschichtsdidaktik dringend empfohlen. Der Band hebt die geschichtsdidaktische Theorie auf ein neues Niveau."
Bernd-Stefan Grewe, hsozkult.de
„Der Band beschreitet den innovativen Weg, einen Geschichtsunterricht zu denken, der wohltuend auf die unter Geschichtsdidaktikern oft übliche Lehrerschelte und die sprachliche Verklausulierung beobachteten Unterricht verzichtet.“
Tobias Dietrich, geschichte für heute 1/2019
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Mit dem vorliegenden Band ist die empirische Wende zur Erforschung des historischen Denkens und Lernens im Geschichtsunterricht auf der Ebene der Elementar- und Primarstufe angekommen. Im Zentrum der hier versammelten Forschungsprojekte stehen die Vorstellungen junger Schülerinnen und Schüler zu Metakonzepten sowie die damit zusammenhängenden Kompetenzen und deren Fortentwicklung. Weitere Schwerpunkte bilden sowohl die Bereiche Differenzierung und Heterogenität als auch die Ausbildung von angehenden Lehrkräften für den Primarstufenbereich. Es zeigt sich, dass Grundschülerinnen und -schüler in der Lage sind, historisch zu denken und auf der Metaebene über Vergangenheit, Geschichte und theoretische Erkenntnisprozesse im Fach zu reflektieren. Passende Lerngelegenheiten können einen conceptual change einleiten.
Das gezielte Formulieren und Erkennen lernwirksamer Aufgaben sind zentrale Aspekte professioneller Kompetenz bei Geschichtslehrkräften. Auf der theoretischen Basis eines Kompetenzmodells für historisches Lehren steht die Entwicklung und Validierung eines vignettengestützten Testinstruments zur situierten Erfassung professioneller Kompetenz im Mittelpunkt der Studie. Die einzelnen Phasen der Testvalidierung werden ausführlich dargestellt und in Bezug auf die Güte des entwickelten Vignettentests reflektiert. Ergebnisse aus einer querschnittlich angelegten Haupterhebung liefern Hinweise auf Faktoren, die geschichtsdidaktische Kompetenzen beim Formulieren von Aufgaben bei angehenden Geschichtslehrkräften beeinflussen können. Die Studie leistet somit einen Beitrag zur geschichtsdidaktischen Professionalisierungsforschung.
Geschichtsunterricht erforschen
Der Band „Geschichte lernen digital“ widmet sich dem historischen Lernen in der digital geprägten Lernumgebung segu. In einer Angebot-Nutzungs-Studie analysiert Lena Liebern zum einen das Lernangebot der Plattform. Zum anderen wertet sie den Umgang von Schüler*innen mit digitalen Medien aus. Dabei steht die (non)verbale Kommunikation über verschiedene Aufgabenformate im Fokus, um Praktiken historischen Denkens zu rekonstruieren. Die Autorin stellt heraus, dass digital geprägte Lernumgebungen den Geschichtsunterricht nicht radikal verändern, sondern eine Veränderung der kulturellen Praktiken im Umgang mit Quellen und Darstellungen hervorgerufen haben.
Dieser Band klärt die Frage, wie Schweizer Jugendliche die Geschichte ihres Landes erzählen. Aus dem Inhalt („Was?“) und der Struktur („Wie?“) der analysierten Texte erfolgen Vorschläge zur Bewertung historischer Erzählungen von Jugendlichen.
Die Studie „Geschichte und Gesellschaftslehre“ wendet sich historischen Lehr-Lern-Prozessen in Unterrichtsreihen zu. Wie gestalten sich die Anbahnung und Performanz historischen Lernens in Unterrichtsreihen? Welche Lerneffekte lassen sich beschreiben? Die Studie ist in der Phänomen-, Ergebnis- und Wirkungsforschung angesiedelt und kombiniert Videographien, Lehrer*inneninterviews und Schüler*innenbefragungen. Das Untersuchungsdesign aus Vor- und Nacherhebung, Unterrichtsvideographie und Stabilitätsmessung ermöglicht auch Erkenntnisse zur Stabilität historischer Lernprozesse in den Themenfel…
Klassengespräche haben ein großes Lernpotenzial hinsichtlich der Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Geschichtsunterricht. Zentrale Qualitätskriterien sind dabei eine dialogische Gesprächsleitung und ein diskussionsanregender Gesprächsanlass. Diese Studie untersucht, wie sich die Gesprächsleitungskompetenz von drei Geschichtslehrer*innen im Lauf einer einjährigen Fortbildung zu dialogischer Gesprächsführung veränderte. Dabei wird aufgezeigt, wie gelingende dialogische Klassengespräche im Geschichtsunterricht gestaltet werden können. Aus der Untersuchung können zudem Merkmale für erfolgreiche Fortbildungen abgeleitet werden.
Was kann man aus der Geschichte für das Leben lernen? Für dieses Buch wurde empirisch erforscht, welche Überzeugungen in dieser Frage unter österreichischen Lehrpersonen bestehen. Das Buch ist Ergebnis eines Habilitationsprojektes, im Zuge dessen 50 qualitative Interviews mit Lehrpersonen in Wien geführt wurden. Die erhobenen Daten machen es möglich, die "Philosophie des Faches" bzw. den Bildungswert, den die Lehrpersonen ihrem Fach beimessen, umfassend zu rekonstruieren.
Dieser Band versammelt theoretische Perspektiven, konzeptionelle Ansätze und empirische Erkenntnisse zur Professionalisierung von Geschichtslehrpersonen. Neben einem Überblick über die bisherigen methodologisch-methodischen Ausrichtungen werden auch bisher kaum berücksichtigte sowie neue Zugänge zu diesem Feld vorgestellt. Darüber hinaus bietet der Band beispielhaft praktische Vorschläge für die Initiierung von Professionalisierungsprozessen in der Hochschullehre und diskutiert, was als domänenspezifisches Professionswissen verstanden werden kann und wie die Forschung in diesem Feld weiterentwickelt werden könnte.
Es gibt bisher kaum empirische Erkenntnisse über historische Vorstellungen und Kompetenzen junger Kinder. Diese Studie stellt dazu drei zentrale Forschungsfragen: 1. Zu welchen historischen Inhalten verfügen Kinder bereits vor der ersten Geschichtsstunde über Vorstellungen? 2. Wie bildet sich Historie in den Vorstellungen der Kinder ab? 3. Welche Ausprägungen historischer Kompetenzen zeigen sich in der Auseinandersetzung mit Historie? Aus einer breiten Datengrundlage (Gruppenerhebungen mit 25 dritten Klassen und 68 teil-standardisierte Einzelinterviews mit Neunjährigen) ergibt sich, dass Kinder dieses Alters hinsichtlich aller historischen Epochen über Vorstellungen verfügen und in kategorisierenden wie prozeduralen Bereichen bereits Kompetenzen ausgeprägt haben. Anfangsunterricht kann also auf bereits vorhandene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften zu historischem Denken aufbauen. Lehrkräfte sollten diese Chance gezielt nutzen.
Vor rund einem Jahrzehnt wurde in Österreich die domänenspezifische Kompetenzorientierung im Fach Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung curricular verordnet. Dies war ein Paradigmenwechsel, der den fachdidaktischen theoretischen Diskurs seither stark befruchtet. Doch wie ist die Kompetenzorientierung in der Praxis des Unterrichts und in den Überzeugungen von Lehrpersonen angekommen? Dieser Frage wurde im Rahmen zweier vom Autor an den Universitäten Salzburg und Oxford durchgeführten Forschungsprojekte empirisch nachgegangen. Der Autor hat 50 qualitative Interviews mit in der Praxis stehenden Lehrpersonen zahlreicher verschiedener Schulen durchgeführt und ausgewertet. Auf diese Weise konnte das Kompetenzverständnis der Lehrpersonen und deren Überzeugungen und Vorbehalte zum Thema Kompetenzorientierung umfassend rekonstruiert werden.
Any attempt to improve history education depends on a sound knowledge of its current state as well as of possible alternatives. Aiming to broaden nationally limited educational discourse, this book brings together twelve perspectives on history education research from across Europe and America. With a focus on empirical research, each chapter outlines national as well as disciplinary traditions, discusses findings and methodology and generates perspectives for future research, thus allowing insight into remarkably rich and diverse academic traditions. Since the publication of the first edition of this book, empirical research on historical thinking and learning has intensified and diversified. Therefore, each chapter was revised and extensively updated for this second edition. In order to adequately reflect the ever-growing field of research, several authors chose to bring on a coauthor for the updated version of their paper. Additionally, a new introduction provides a comparative perspective on the chapters contained in this volume.
Das gezielte Formulieren und Erkennen lernwirksamer Aufgaben sind zentrale Aspekte professioneller Kompetenz bei Geschichtslehrkräften. Auf der theoretischen Basis eines Kompetenzmodells für historisches Lehren steht die Entwicklung und Validierung eines vignettengestützten Testinstruments zur situierten Erfassung professioneller Kompetenz im Mittelpunkt der Studie. Die einzelnen Phasen der Testvalidierung werden ausführlich dargestellt und in Bezug auf die Güte des entwickelten Vignettentests reflektiert. Ergebnisse aus einer querschnittlich angelegten Haupterhebung liefern Hinweise auf Faktoren, die geschichtsdidaktische Kompetenzen beim Formulieren von Aufgaben bei angehenden Geschichtslehrkräften beeinflussen können. Die Studie leistet somit einen Beitrag zur geschichtsdidaktischen Professionalisierungsforschung.
Mit dem vorliegenden Band ist die empirische Wende zur Erforschung des historischen Denkens und Lernens im Geschichtsunterricht auf der Ebene der Elementar- und Primarstufe angekommen. Im Zentrum der hier versammelten Forschungsprojekte stehen die Vorstellungen junger Schülerinnen und Schüler zu Metakonzepten sowie die damit zusammenhängenden Kompetenzen und deren Fortentwicklung. Weitere Schwerpunkte bilden sowohl die Bereiche Differenzierung und Heterogenität als auch die Ausbildung von angehenden Lehrkräften für den Primarstufenbereich. Es zeigt sich, dass Grundschülerinnen und -schüler in der Lage sind, historisch zu denken und auf der Metaebene über Vergangenheit, Geschichte und theoretische Erkenntnisprozesse im Fach zu reflektieren. Passende Lerngelegenheiten können einen conceptual change einleiten.
In dieser Studie wird erstmals die Wirksamkeit der Arbeit mit Zeitzeugen (live, Video, Text) im Geschichtsunterricht in einem belastbaren Design mit einer ausreichend großen Stichprobe (900 Schülerinnen und Schüler) empirisch erfasst. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt: Welche Erwartungen knüpfen sich – ausgehend von der umfangreichen theoretischen Literatur zum Thema – an die Arbeit mit Zeitzeugen im Geschichtsunterricht? Wie kann die Wirksamkeit der Methode mit psychometrisch reliablen Instrumenten erfasst werden? Können mithilfe der Zeitzeugenmethode Kompetenzen historischen Denkens gefördert werden? Welche Vor- und Nachteile sind mit den verschiedenen Formen der Zeitzeugenbefragung (Live-Befragung versus Arbeit mit Zeitzeugen- „Konserven“) verbunden?
Die Geschichtsdidaktik hat den Geschichtsunterricht wiederentdeckt. Im Zentrum dieses Bandes steht eine als Transkript dokumentierte Doppelstunde zur Oktoberrevolution. Erstmals begeben sich unterschiedliche Fachleiter und renommierte Geschichtsdidaktiker auf die Suche nach Merkmalen guten Geschichtsunterrichts, indem sie ihren Blick auf einen gemeinsamen Datensatz richten. Sie profilieren ihre eigenen Urteilsmaßstäbe und äußern sich zur didaktischen Qualität der untersuchten Geschichtsstunde. Außerdem werden die Perspektiven des Lehrers und der Schüler untersucht.
Kunst und Historie, Emotionen und Geschichte – passen die wirklich zusammen, haben sie überhaupt etwas miteinander zu tun? Geschichtslernen stellt – das sagt unsere eigene Erfahrung – einen nicht-nur-kognitiven Prozess dar. Emotionen, Ästhetik, Moral, Politik, Imagination, Triebdynamik usw. haben ihren Anteil an Auslösung, Verlauf und Ergebnis; sie treiben nicht nur Lernen an, sondern ändern sich auch durch Umgang mit Geschichte. Unterrichtspraxis und akademische Geschichtsdidaktik haben diesen Zusammenhang bisher weitgehend ausgeblendet. In diesem Band werden an exemplarischen Fällen die Urgewalt und Unvermeidlichkeit der nicht-nur-kognitiven Momente des Geschichtslernens aufgezeigt, um anschließend anzudeuten, wie Ästhetik und Emotionalität in Unterrichtspraxis und geschichtsdidaktischer Theorie ehrlicher reflektiert und integriert werden könnten.