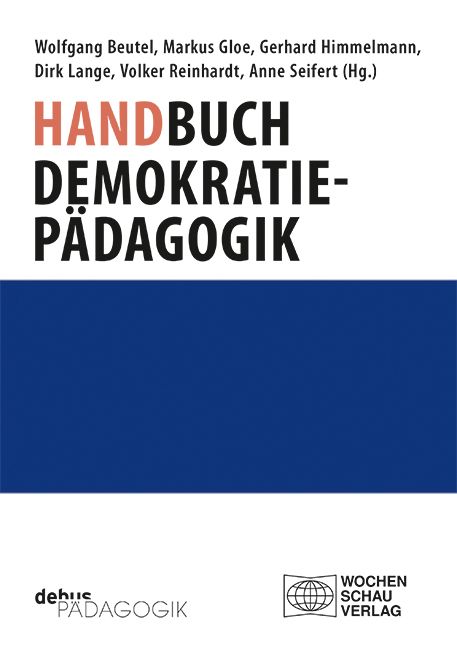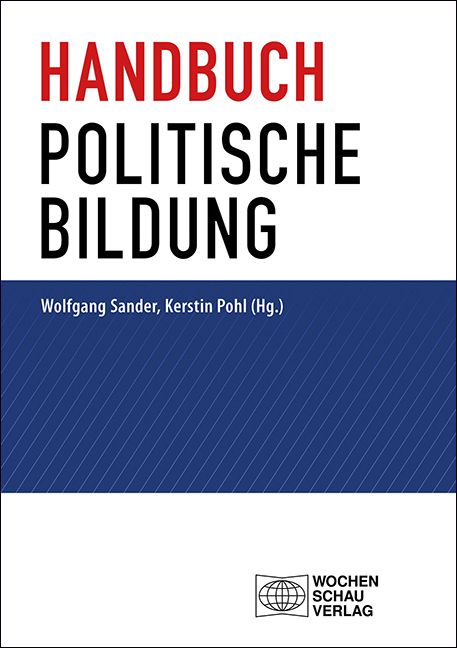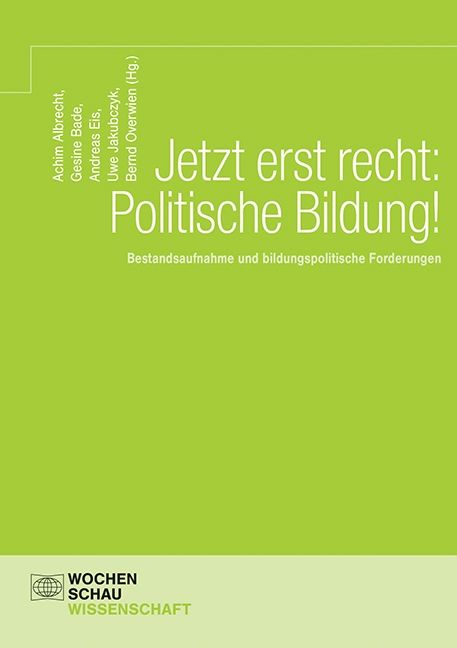Zu "Dirk Lange" wurden 42 Titel gefunden
Der Band bietet pädagogische Überlegungen, die angesichts vielfältiger Krisen dazu beitragen, die Gefahr der Distanz zwischen Bürgerschaft und Demokratie zu verringern, Krisenerscheinungen als Lernanlässe zu verstehen und produktiv damit umzugehen.
„Gerechtigkeit“ ist zweifellos kein neues Thema, es hat aber angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen in den Themenfeldern Gesundheit, Klima, Politik, Wirtschaft und Soziales an Relevanz gewonnen. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass eine verstärkte Polarisierung und damit Verschärfung von Ungleichheiten nachweisbar war und die politischen Maßnahmen eher nach dem Gießkannenprinzip erfolgten, während es eigentlich passgenauer Instrumente bedurft hätte. Gerechtigkeit und Ungleichheit bleiben damit gesellschaftliche Herausforderungen und drängende politische Fragen, die auch unter…
Der Band beschäftigt sich mit zentralen Konzepten der Demokratie(bildung) und diskutiert, wie diese im Sinne der Inklusion möglichst vieler Menschen genutzt werden können.
Im zweiten Band der Reihe sprache – macht – gesellschaft erörtern Forscher*innen aus Sprachforschung, Politikwissenschaft und Politischer Bildung das Feld Europabildung. Im Fokus stehen dabei die Themen Gleichheit und Ungleichheit, Bildungsgerechtigkeit und -ungerechtigkeit, der Umgang mit gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit sowie Formen von Integration, Diskriminierung und Exklusion durch Sprache. In der Europabildung zeigt sich die Verknüpfung historisch-politischer und sprachlicher Bildung in besonderem Maße. Der vorliegende Band macht die Anschlussfähigkeit der verschiedenen Zugänge sich…
Ausgehend von Ideen der Citizenship Studies entwickelte sich die Forschungsperspektive Inclusive Citizenship für die politische Bildung. Im Zentrum des Ansatzes Inclusive Citizenship steht das Spannungsverhältnis zwischen zwei Bedeutungsdimensionen von Citizenship. Citizenship als Ordnung auf der einen Seite sowie Citizenship als Acts auf der anderen. Mit Acts of Citizenship sind diejenigen Kämpfe bezeichnet, mit denen genau diese Citizenship-Ordnungen infrage gestellt oder transformiert werden. In dieser Ausgabe wird dabei auf die migrationsgesellschaftlichen Aspekte fokussiert. Dieser Schwe…
Politische Fähigkeiten und demokratische Haltungen zu entwickeln, sind Bildungsziele aller Schulformen. Die Wirklichkeit widerspricht vielfach diesen Zielen. Aktuelle Daten zeigen, dass Politischer Bildung nur eine geringe Bedeutung in der Schule zukommt und dass sie häufiger als jedes andere Fach fachfremd unterrichtet wird. Den Herausgeber*innen dieses Sammelbandes geht es darum, die längst überfällige Debatte über die dringend notwendige Stärkung Politischer Bildung anzustoßen. Die Empfehlungen in diesem Band wurden von ca. 100 Expert*innen erarbeitet und richten sich an bildungspolitische Akteure in den Landtagen, an Fachverbände, Gewerkschaften sowie an Universitäten, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen.
Populismus ist ein Politikstil, der gesellschaftliche Ängste katalysiert und sich in Krisenzeiten zu deren Sprachrohr macht. Statt moderne Lösungen zu ermöglichen, führt Populismus zu Ausgrenzung und Denkverboten.Dieser Band analysiert Strukturen in Politik und Geschichte und liefert fachwissenschaftliche Reflexionen sowie konkrete Unterrichtsstunden. Er bietet Materialien zu Themen der Erinnerungskultur und der Mythenbildung, zu Begriffsdefinition und Urteilsbildung. Ein Argumentationstraining und ein Mystery-Rätsel eröffnen handlungsorientierte Vorschläge für die Praxis.
In diesem Band wird das viel diskutierte Phänomen der "Krise der Demokratie" aus der Perspektive verschiedener Fachwissenschaften analysiert. Ausgehend von dem Begriff einer "multiplen Krise" befassen sich die Beiträge mit (sozio)ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der aktuellen Krise. Prominente Autor*innen gehen der Frage nach, welchen Einfluss der Neoliberalismus auf Demokratie und Menschenrechte hat und wie sich die Entwicklung vom Neoliberalismus hin zum Illiberalismus vollzogen hat. Daran anknüpfend werden Tendenzen des Autoritarismus sowie Ideologie und Strategie der populistischen und extremen Rechten in Zeiten der 'multiplen Krise' beleuchtet. Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, welchen Beitrag politische Bildung zur Überwindung der Krise der Demokratie leisten kann. Diese Fragen werden von ausgewiesenen politischen Bildner*innen nicht nur auf theoretischer Ebene diskutiert, sondern anhand konkreter Praxisbeispiele illustriert.
Die Ausbildung von Lehrer*innen ist Dreh- und Angelpunkt für die nachhaltige Stärkung der Demokratiepädagogik. In Zeiten wachsender Herausforderungen für die Demokratie ist die Festigung demokratischer Bildung in der Schule zunehmend von Bedeutung. In ihren Funktionen als Multiplikator*innen und Vorbilder können Lehrkräfte mit der richtigen Ausbildung zu Botschafterinnen und Botschaftern der Demokratie werden. Theoretische und praxisorientierte Beiträge zeigen das Potenzial einer demokratischen Neuausrichtung in der Lehrer*innenbildung. Die Reihe wird ab dem Jahrgang 2023 in der neuen Reihe Jahrbuch Demokratiepädagogik und Demokratiebildung fortgeführt.
Ziel von Citizenship Education sind mündige Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die in der Lage sind, in bestehenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Systemen zu agieren und darüber hinaus Herrschafts- und Machtstrukturen zu analysieren, sich ein kritisch-reflektiertes Urteil zu bilden und selbst aktiv politische Prozesse zu beeinflussen. Diskutiert wird dabei auch, wie soziale und politische Teilhabe ermöglicht und politikdidaktisch begleitet werden kann. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Fachdidaktik, der Menschenrechtsbildung und der Soziologie widmen sich Lehrkräfte und politische Bildnerinnen und Bildner aus der außerschulischen Praxis in diesem Band den (globalen) Herausforderungen gelingender Demokratiebildung. Auch Schülerinnen und Schüler kommen in einem Gastbeitrag zu Wort. Das Grundlagenbuch richtet sich an alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der Lehrkräftebildung.
Die Autorinnen und Autoren der Publikation diskutieren das Verhältnis von Emanzipation und politischen Bildungsprozessen und setzen sich aus verschiedenen Teilbereichen und Disziplinen (u.a. demokratietheoretisch, sozioökonomisch, lebensweltlich, exklusionskritisch, bildungspraktisch) mit didaktischen Konzepten um Mündigkeit und Aufklärung auseinander.Mündigkeit als Ziel politischer Bildung spiegelt sich am Begriff „Emanzipation“. Doch wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Diskurse in den didaktischen Strategien wider? Welche Konzepte mündiger BürgerInnenschaft werden verhandelt und welche Herausforderungen ergeben sich im Kontext von Unmündigkeit und kritischer Subjektbildung?Das Grundlagenbuch vereint Beiträge aus Wissenschaft, Hochschullehre und Unterrichtspraxis und richtet sich an Lehrkräfte, MultiplikatorenInnen und DozentInnen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sowie der LehrerInnenbildung.
Die Jahrestagungen der Interessensgemeinschaft Politische Bildung (IGPB) bieten ein wichtiges Forum für die strukturierte Auseinandersetzung mit aktuellen inhaltlichen Anforderungen, vor die sich die Politische Bildung gestellt sieht. Der vorliegende Band fasst die Inhalte der sechsten und siebten Jahrestagung zusammen, in deren Rahmen die Themen „Populismus als Herausforderung für Politische Bildung“ und „Gleichheit und Differenz in der politischen Bildung“ diskutiert wurden.
Seit mehr als zwei Jahrzenten gibt es in Deutschland Bildungsansätze zu globalen Problemlagen, die in unterschiedlicher Weise globale politische Fragen thematisieren. Dabei geht um ein Begreifen des globalen Wandels mit dem Ziel, Kompetenzen für weltweite Veränderungsprozesse zu entwickeln. Fragen globaler Gerechtigkeit, von Macht- und Herrschaft oder auch Rassismus, werden in unterschiedlicher Weise und Akzentuierung angesprochen. Dies ist seit einigen Jahren auch in den Curricula der Länder angekommen. Robert Schreiber stellt hier die Neuausgabe des „Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung“ der Kultusministerkonferenz vor, der globale Fragen in fast alle Fächer der Schule bringen will. Hierbei wird deutlich, dass Globales Lernen heute weitgehend als Teil von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gesehen wird. Die anderen Beiträge liefern verschieden Perspektiven auf Globales Lernen.So analysieren Anna-Lena Lillie und Jasper Meya den Beitrag von BNE für die politische Bildung. Fischer u.a. stellen die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vor, das Schülervorstellungen von Globalisierung nachgegangen ist. Das Arbeitsfeld der Inklusion kommt auch aus dem internationalem Kontext in deutsche Schulen. Marie Bludau diskutiert Zusammenhänge zum Globalen Lernen.Globales Lernen thematisiert schon sehr lange Problemlagen, die mit Fluchtursachen in ganz direktem Zusammenhang stehen.Sönke Zankel liefert in der Didaktischen Werkstatt einen Überblick über ein Schulprojekt, das sich in heimischen Gefilden mit globalen Fragen sehr praktisch befasst. Es geht um die aktuelle Flüchtlingssituation.Damit schließt sich der Kreis zwischen oft abstrakten globalen Problemlagen und einigen der Konsequenzen auf lokaler Ebene.
Deutschland ist ein Land, das seit mehreren Jahrzehnten von Migration und migrationsbedingten Veränderungen der Sozialstruktur geprägt wird. Bereits jetzt hat ca. 20 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Durch die hohe Anzahl von Menschen, die seit 2014 nach Deutschland gekommen sind, stellen sich umso mehr die Fragen nach dem Selbstverständnis einer pluralen (Einwanderungs-)Gesellschaft und den Folgen für die Ziele, Bedingungen und Prozesse der politischen Bildung. Der Band dokumentiert Beiträge u.a. zu folgenden Fragestellungen: Welche Folgen ergeben sich durch Migration für politische und gesellschaftliche Werte unserer Gesellschaft? Welche Themen und Fragestellungen sollten in Zukunft stärker in den Fokus der politischen Bildung rücken? Welche Methoden eignen sich besonders, um unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden?
Insgesamt 28 Autorinnen und Autoren erläutern in Interviews ihre Positionen zur politischen Bildung. Sie nehmen Stellung zu Inhalten, Zielen, Methoden und Medien der politischen Bildung in der Schule, reflektieren politikdidaktische Prinzipien und gehen auf die neuen Kontroversen in der Didaktik der politischen Bildung ein. Mit dem ersten Band „Positionen der politischen Bildung“ hatte Kerstin Pohl bereits ein Standardwerk der schulischen Politikdidaktik vorgelegt. Ergänzt um 18 Autoren zeigt sich, was sich in der Politikdidaktik getan hat: Neben neuen Professuren sind auch neue Fragen hinzugekommen. Welche Rolle spielen Kompetenzen? Wie stark sollte eine Fächerintegration stattfinden? Welche Bedeutung hat die empirische Forschung für die Politikdidaktik? Mit gutem Gewissen kann man sagen, dass der zweite Band des erfolgreichen Interviewbuches den „state of the art“ der Politikdidaktik präsentiert. Zusammen spiegeln die beiden Bände die Entwicklung der Disziplin Politikdidaktik seit 2003 bis in die Gegenwart.
Die enorme Anzahl der Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung, Bürgerkrieg und sozialem Elend in Europa Schutz suchen, wird zur Herausforderung für den Zusammenhalt des Kontinents und für die politische Stabilität Deutschlands. In diesem Band wird das Phänomen Flucht und Vertreibung in einen größeren historisch-politischen Zusammenhang gestellt und mit der aktuellen Migrationskrise in Verbindung gesetzt. Die Beiträge beleuchten aus historischer, politikwissenschaftlicher, psychologischer und didaktischer Sicht zahlreiche Aspekte der hochkomplexen Flüchtlingsthematik. Auch Sonderaspekte wie Filme über Flucht und Vertreibung sowie der Umgang mit fluchtbedingten Traumata werden berücksichtigt und die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland ausführlich erörtert. Der Band will dazu beitragen, den Angstreaktionen in Teilen der Bevölkerung zu begegnen und das historisch-politische Denken in rationalere Bahnen zu lenken. Er wendet sich vor allem an Lehrende in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung sowie an alle, die sich für das Thema interessieren oder sich mit der Problematik von Flucht und Vertreibung näher auseinandersetzen wollen. Für die tägliche Arbeit der Lehrenden enthält das Buch wertvolle Hinweise auf Materialien zur Behandlung des Themas im Unterricht. Es bietet eine Fülle von Hinweisen und Anregungen zur Bearbeitung der entscheidenden Fragen, wie die Integration von Flüchtlingen und Migranten gelingen kann und welchen Beitrag die international seit langem geforderte Menschenrechtsbildung in unseren Schulen dazu leisten sollte.