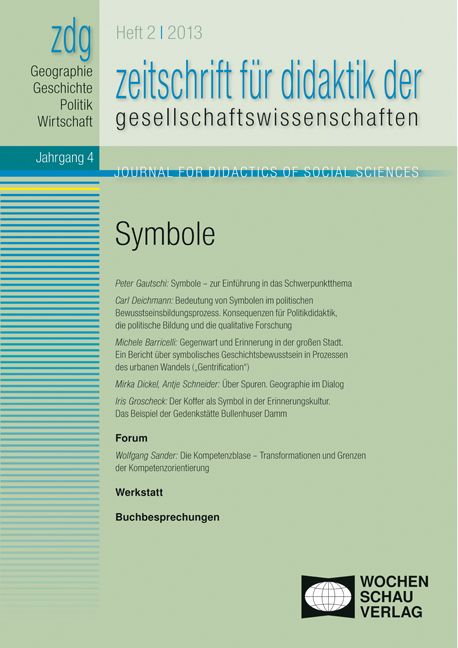Quo vadis?
- herausgegeben von
- Peter Gautschi, Tilman Rhode-Jüchtern, Wolfgang Sander, Birgit Weber
- unter Mitarbeit von
- Anja Bonfig, Tessa Debus, Peter Gautschi, Matthias Häberlin, Christoph Luzi, Tilman Rhode-Jüchtern, Wolfgang Sander, Annette Scheunpflug
Gegründet vor 10 Jahren, trat die „Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften“ (zdg) dafür an, Diskurse zu führen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Eine gemeinsame Sprache zu sprechen ist eine unabdingbare Notwendigkeit, wenn es darum geht, Synergien zu schaffen. Es ist aber auch keine leichte Aufgabe, wenn man realpolitisch beobachtet, wie jeweilige Disziplinen um ihre Ressourcen kämpfen (von Schulstunden bis Professuren). Die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen ist eine Herausgeber-Edition. Sie ist im editor-review statt im double-blind-peer Review Verfahren entsta…
| Bestellnummer: | 40906 |
|---|---|
| EAN: | 9783734409066 |
| ISBN: | 978-3-7344-0906-6 |
| Reihe: | zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Auflage: | 1 |
| Seitenzahl: | 168 |
- Beschreibung Gegründet vor 10 Jahren, trat die „Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften“ (zdg) dafür an, Diskurse zu füh… Mehr
- Inhaltsübersicht Tessa Debus: Quo vadis Gesellschaftswissenschaften? Schwerpunkt Birgit Weber: Die Didaktiken der Gesellschaftswissenschaften… Mehr
- Autor*innen Anja Bonfig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildu… Mehr
Gegründet vor 10 Jahren, trat die „Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften“ (zdg) dafür an, Diskurse zu führen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Eine gemeinsame Sprache zu sprechen ist eine unabdingbare Notwendigkeit, wenn es darum geht, Synergien zu schaffen. Es ist aber auch keine leichte Aufgabe, wenn man realpolitisch beobachtet, wie jeweilige Disziplinen um ihre Ressourcen kämpfen (von Schulstunden bis Professuren). Die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen ist eine Herausgeber-Edition. Sie ist im editor-review statt im double-blind-peer Review Verfahren entstanden – so wie die allererste Ausgabe „Wissen“. Was resümieren die Herausgeber/-in, die jeweils ihr Fach repräsentieren?
Tessa Debus: Quo vadis Gesellschaftswissenschaften?
Schwerpunkt
Birgit Weber: Die Didaktiken der Gesellschaftswissenschaften zwischen Zersplitterung, Dominanz und Interdependenz
Peter Gautschi: Lehrer/-innenbildung für das Integrationsfach „Gesellschaftswissenschaften“ – Impulse, Kernideen, Perspektiven
Tilman Rhode-Jüchtern: „Klimaleugner“, „Entsorgung“, „Naturkatastrophe“ – Begriffe als Argument
Wolfgang Sander: Zurück zur Bildung? Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer nach der Kompetenzorientierung
Forum
Annette Scheunpflug: Bildung in der politischen Bildung – didaktische Herausforderungen
Werkstatt
Anja Bonfig: Lebensweltorientierung in den Didaktiken der Sozialwissenschaften und der Sonderpädagogik – zwischen Lebenshilfe und Gesellschaftsperspektive
Matthias Häberlin: Didaktische Integration der digitalen Transformation im Fachbereich der Gesellschaftswissenschaften
Christoph Luzi: Geschichte und die digitalisierte Demokratie
Buchbesprechungen
Sebastian Bracke u. a.: Theorie des Geschichtsunterrichts (Geschichtsunterricht erforschen, 9) (von Barbara Hanke)
Reinhold Hedtke: Das sozioökonomische Curriculum (von Andreas Lutter)
Alexander Wohnig, Stefan Müller-Mathis (Hg.): Wie Schulbücher Rollen formen. Konstruktion der ungleichen Partizipation in Schulbüchern (von Kerstin Pohl)
Vadim Oswalt: Karten als Quelle und Darstellung. Historische Karten und Geschichtskarten im Unterricht (von Thomas Must)
Heike Wolter: Forschend-entdeckendes Lernen im Geschichtsunterricht (von Lukas Greven)
Abstracts
Autorinnen und Autoren dieses Heftes
Anja Bonfig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung der Universität zu Köln. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Ökonomische/Finanzielle Bildung, Inklusion.
Tessa Debus ist Politikwissenschaftlerin und Verlegerin des Wochenschau Verlages und damit auch der zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften (zdg). Sie ist zudem Mitherausgeberin des „Journal of human rights“ (zfmr).
Peter Gautschi ist Leiter des Instituts für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Unterrichtsforschung und Lehrmittelentwicklung.
Matthias Häberlin ist promovierter Historiker, Gymnasiallehrer und als Dozent an verschiedenen Institutionen u. a. in Studiengängen der Pädagogischen Hochschule Luzern und als ehemaliger Journalist an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern tätig.
Christoph Luzi ist Kulturwissenschaftler und Historiker. Seine Dissertation zum touristischen Geschichtsgebrauch am Beispiel des Konstanzer Konzil wird im kommenden Jahr erscheinen.
Tilman Rhode-Jüchtern war bis 2011 Universitätsprofessor für Didaktik der Geographie an der Universität Jena und bis 2017 Gastprofessor in Hamburg und Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die konstruktive Didaktik und mehrperspektivische Geographie.
Wolfgang Sander ist emeritierter Professor für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universit Gießen. Zuvor war er auf Professuren in Jena, Passau und Wien tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Theorie, Didaktik und Geschichte der politischen Bildung; fächerübergreifendes Lernen in der politischen Bildung, insbesondere im Rahmen der Gesellschaftswissenschaften und mit Religion; Bildung in der Weltgesellschaft.
Annette Scheunpflug ist Professorin für Allgemeine Pädagogik, Arbeitsschwerpunkte Bildungsqualität, weltbürgerliche Bildung, naturwissenschaftliche Anthropologie und Religion und Bildung, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Birgit Weber ist Professorin für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung an der Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Ökonomische/Sozioökonomische Bildung, Curriculumanalyse/-entwicklung, Verbraucher-bildung, Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung / Globales Lernen, Kultur der Selbstständigkeit, Schülervorstellungen
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Zwei Autorengruppen erläutern, was gute politische bzw. ökonomische Bildung ausmacht. Politische Bildung basiert auf der Mündigkeit des Menschen und zielt darauf ab, die Urteilskraft des demokratischen Souveräns zu fördern. Jede und jeder kennt sozialwissenschaftlichen Unterricht, der diese Zielstellung nicht oder kaum erreicht. Dann bleibt nach dem Unterricht ein mulmiges Gefühl bei Lernenden wie Lehrenden zurück. Was lässt sich also besser machen? Der „Leitfaden für den sozialwissenschaftlichen Unterricht“ gibt Antworten auf 17 für die Planung und Durchführung von Unterricht zentrale Fragen. Die Autorinnen und Autoren orientieren sich an den aktuellen fachdidaktischen Diskursen, um den Theorie-Praxis-Austausch in der politischen Bildung zu fördern. Beim Verfassen der Beiträge hatten sie die Frage vor Augen: „Wie kann ich bei der Planung, der Durchführung und der Reflexion sozialwissenschaftlichen Unterrichts vom Stand der didaktischen Forschung profitieren?“ Ökonomische Bildung ist dringend notwendig. Die Ökonomisierung aller Lebenswelten erfordert es, ökonomische Phänomene erkennen zu können, ökonomisches Denken zu fördern sowie die Fähigkeit, ein fundiertes Analysieren, Verarbeiten und Kombinieren von Informationen zu entwickeln. Oft jedoch wird lediglich herbeigewünscht, dass in den Unterrichtsstunden mehr Zeit und Raum für die Auseinandersetzung mit finanziellen Problemen oder das Lesen von Versicherungsverträgen gegeben wird. Es lohnt sich, in die bestehenden Unterrichtsmaterialien hineinzuschauen, die unter dem Etikett ökonomische Bildung firmieren, um zu sehen, was dort tatsächlich geboten wird: Häufig beschränken sie den Unterricht darauf, die Lernenden in ein eindimensional ausgerichtetes wirtschaftswissenschaftliches Denkmuster einzuführen. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich, dass „traditionelle“ ökonomische Bildung ein problemorientiertes, entdeckendes Erkennen und Lernen in und von komplexen Realitäten nicht bzw. allenfalls in Ansätzen ermöglicht. Die Hoffnung, dass das Hinterfragen, Analysieren und Reflektieren (unterschiedlicher) ökonomischer Perspektiven angeregt wird, bleibt unerfüllt. Die Autorengruppe Sozioökonomische Bildung hat sich davon nicht entmutigen lassen. Auf ihrer Suche nach Zugängen, die es den Lernenden erlauben, die Einflussfaktoren, Wechselwirkungen und Widersprüche von bzw. zwischen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen wahrzunehmen, zu bewerten und ggf. Alternativen zu entwickeln, hat sie Grundgedanken einer sozioökonomischen Bildung entwickelt. Sie zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler sozioökonomische Kompetenzen erwerben, um die Multiperspektivität und Kontroversität der Lebenswelten, aber auch von sozialwissenschaftlichen Sichtweisen zu erfassen. Dazu benennen wir Themen für eine sozioökonomische Bildung, skizzieren Methoden und erörtern grundsätzliche Herausforderungen und Perspektiven, die sie mit sich bringt. Wir sind davon überzeugt, dass eine sozioökonomische Bildung dem Bildungsauftrag der Schule gerecht wird, also die Lernenden bildet, statt sie nur zu einem einseitig ökonomisch orientierten Handeln anzuleiten. Kurzum: Sozioökonomische Bildung ist zugleich handlungs- und ergebnisorientiert, offen für unterschiedliche Perspektiven und Lösungsansätze. Sie bietet damit ein hohes Innovationspotenzial für jeden Unterricht und für die daran beteiligten Akteure.
zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften
Die Zeitschrift bietet ein gemeinsames wissenschaftliches Forum für die Didaktiken im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Sie befasst sich mit fachspezifischem und mit fächerübergreifendem Lehren und Lernen und schlägt Brücken zwischen den Didaktiken der gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen Geographie, Geschichte, Politik und Wirtschaft , der Erziehungswissenschaft und der Lehrerbildung.Weitere Informationen zur zdg Für Studierende und Referendar*innen bieten wir die zdg für die Dauer der Ausbildung zum halben Preis an. Bitte reichen Sie zeitnah eine entsprechende Bescheinigung nach.Kündigung 8 Wochen (30. April bzw. 31. Oktober) vor dem Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.
Heft 2/2021 der zdg versammelt vielfältige Beiträge zu „Erinnerung“, etwa phänomenologische Überlegungen, Gesellschaftsanalysen, der erinnerungskulturelle Umgang mit Holocaust sowie Reflexionen zum Zusammenhang von Digitalität und Erinnerung.
Identität ist in jüngster Zeit mehr und mehr von einem individual- und sozialpsychologischen Konzept zu einem politischen Kampfbegriff geworden, mit dem um Verhältnisbestimmungen von Diversität und Integration in der Gesellschaft gerungen wird. Die damit verbundenen Probleme und Kontroversen haben inzwischen auch die Fachdidaktiken und die Bildungspraxis erreicht. Das Heft fragt nach der grundsätzlichen Relevanz dieses Themas für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, insbesondere mit Blick auf demokratische Identität und auf Antisemitismus, und stellt identitätsbezogene Forschungen zu S…
Fächerintegration ist in den Gesellschaftswissenschaften ein gängiges Muster der Fächerorganisation, wovon Fächer wie Geschichte-Politik, Politik-Wirtschaft, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Geographie-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Recht, Sozialkunde oder Gesellschaftslehre ein beredtes Zeugnis geben. Diese offerieren – integriert oder spezialisiert - Lernenden ähnliche Felder gesellschaftlicher Realität mit zum Teil gleichen Fragestellungen, aber auch divergierenden Perspektiven. Es existieren also gute Gründe, sich den Chancen und Herausforderungen der Fächerintegration konzeptionell und empirisch zu nähern. In diesem Heft entwickeln Frederica Valsangiacomo, Dagmar Widorski und Christine Künzli David eine Systematik „transversalen Unterrichtens“ aus bildungstheoretischer Perspektive. Entzündet am Streit um ein Fach Wirtschaft befasst sich Thorsten Hippe mit dem „Kampf der Kulturen“ zwischen Politik- und Wirtschaftsdidaktik, dem er ein Plädoyer einer „bedingten Interdisziplinarität“ gegenüberstellt. Oliver Plessow analysiert das Verhältnis „Geschichte mit Gemeinschaftskunde“ an baden-württembergischen Berufsgymnasien in Bildungsplan und Zentralprüfungen auf gelingende Fächerintegration, während Volker Rexing die politische Bildung in die Lernfeldkonzeption der beruflichen Bildung integriert. Eine Bestandsaufnahme der gesellschafts¬wissen¬schaftlichen Fächerverbünde sowie einen Diskussionsvorschlag möglicher Perspektiven legt Thomas Brühne vor. Auch in den Forumsbeiträgen existieren inhärente fächerübergreifende Bezüge, wenn Marie Winckler die Berücksichtigung der interdisziplinären Gender Studies für die politische Bildung einfordert, Carsten Quesel, Carmine Maiello und Susanne Burren den Lernzuwachs in Miniunternehmen aus psychologischer und soziologischer Perspektive evaluieren und Alexandra Binnenkade mit der „Quelle“ ein zentrales geschichtsdidaktisches Konzept – auch mit Bedeutung für andere gesellschaftswissenschaftliche Fächer – hinterfragt. Auch die Werkstattbeiträge liefern einen lebendigen Einblick in das Schwerpunktthema. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.
Komplexe Zusammenhänge in der Geschichte, Geographie, Politik, Wirtschaft lassen sich selten „als solche“ didaktisch behandeln; sie müssen vielmehr reduziert, verdichtet und verständnisintensiv werden. Dies kann durch Modelle, Bilder oder Erzählungen geschehen, die auf spezifische Adressaten gerichtet und von diesen sinngemäß interpretiert werden. Der Sinn kann in der Sache liegen und in der Hinsicht des Betrachters – eine Sinn-Vorgabe oder eine Sinn-Zugabe. Die Narration ist ein traditionelles Format zum Verstehen von Welt, als Prozess oder als Produkt. Hier wird über einen Fall/eine Figur/eine Idee Verständnis in einer Sache ermöglicht und das Entschlüsseln, Verallgemeinern und Relativieren geübt. Neben der Kleinen Erzählung zum Verstehen von Großen Erzählungen gibt es eine weitere Dimension des Begriffsfeldes, nämlich das Narrativ. Narrative können als Erklärungsansätze (im Sinne von Paradigmen) erkannt werden, die für ein bestimmtes Raum-Zeit-System als gültig erscheinen, z.B. national, gruppenspezifisch, zeitweilig, triftig und funktional, aber niemals als universal und endgültig. Auch dies gilt es als Muster zu durchschauen und zu dekonstruieren. Das Heft „Narrationen“ bietet dazu eine Reihe theoretisch gegründeter Anwendungen. Diese sind konzeptionell oder empirisch gefasst; sie sollten zugleich Impulse setzen zur Entwicklung einer reflexiven, dekonstruktiven und narrativen Kompetenz. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.
Symbole lösen im Denken der sie wahrnehmenden Menschen Bedeutung aus. Sie stellen etwas dar, was ohne ihre Hilfe nicht oder nur schwer bedacht oder erfasst werden kann. Menschen können nur auf Grundlage von Symbolen die Welt und die Gesellschaft verstehen. Dementsprechend spielen Symbole im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht eine grosse Rolle. Im Heft „Symbole“ beschäftigt sich Carl Deichmann mit dem Zusammenhang zwischen den politischen Symbolen, dem politischen Bewusstseinsbildungsprozess, der politischen Kultur und der Politikdidaktik und plädiert für einen „weiten Symbolbegriff“. Michele Barricelli berichtet über symbolisches Geschichtsbewusstsein in Prozessen des urbanen Wandels und stellt die zentrale Bedeutung von Symbolen für Geschichte heraus. Mirka Dickel und Antje Schneider stellen ein Studienprojekt auf Sylt vor und machen klar, wie wichtig es in Wissenschaft und Unterricht ist, vom Primat der Frage auszugehen. Iris Groschek schliesslich zeigt in ihrem Beitrag auf, wie der Koffer zum Symbol für die Shoah wurde und wie er in verschiedenen Ausstellungen als Symbol eingesetzt wird. In einem Forumsbeitrag beschäftigt sich Wolfgang Sander mit Transformationen und Grenzen der Kompetenzorientierung, und in der Rubrik Werkstatt berichten verschiedene Autorinnen und Autoren aus Lehre, Forschung und Entwicklung im Bereich der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften. Pointierte und profilierte Buchbesprechungen runden das Heft ab. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.