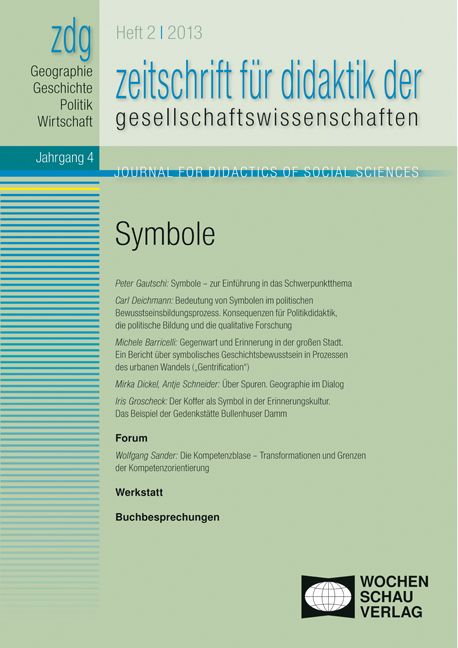Theorie
- herausgegeben von
- Peter Gautschi, Tilman Rhode-Jüchtern, Wolfgang Sander, Birgit Weber
- unter Mitarbeit von
- Melanie Richter-Oertel, Isabelle Muschaweck, Detlef Kanwischer, Stefan Müller, Mirko Niehoff, Hannah van Reeth, Christian Heuer, Stephan Podes, Chiara Fürst, Matthias Zimmermann, Christian Buschmann, Philipp McLean, Martin Buchsteiner
Wie steht es um Theorieentwicklung und -diskussion in den gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken? Die Beiträge des Hefts fragen nach Möglichkeiten theoretischer Forschung, nach dem Verhältnis von pädagogischen und fachwissenschaftlichen Theorien und nach jenem von Fachlichkeit und Transdisziplinarität in den Gesellschaftswissenschaften. Dazu kommen Beiträge zu Dialektik und Urteilsfähigkeit.
| Bestellnummer: | zdg1_23 |
|---|---|
| ISSN: | 2191-0766 |
| Reihe: | zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Auflage: | 1 |
| Seitenzahl: | 184 |
- Beschreibung Theorien sind für die Wissenschaften notwendig, denn ohne sie ist Weltverstehen nicht möglich. Wie aber steht es um Theoriee… Mehr
- Inhaltsübersicht Editorial Wolfgang Sander: Theorie – zur Einführung in das Schwerpunktthema Schwerpunkt Melanie Richter-Oerte… Mehr
- Autor*innen Dr. Martin Buchsteiner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Fachdidaktik des Historischen Instituts der U… Mehr
Editorial
Wolfgang Sander: Theorie – zur Einführung in das Schwerpunktthema
Schwerpunkt
Melanie Richter-Oertel: Transdisziplinarität als theoretische Basis einer gesellschaftswissenschaftlichen Verbundfachdidaktik
Isabelle Muschaweck, Detlef Kanwischer: Raumkonstruktionen und Digitalität aus der Perspektive des TPACK-Modells – Zur Verknüpfung von fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Theorien im Kontext einer praxisorientierten gesellschaftswissenschaftlichen Lehrkräftebildung
Stefan Müller: Die Wiederentdeckung der Dialektik in der politischen Bildung
Mirko Niehoff: Über Gewalt und Zärtlichkeit. Eine Kritik des Gebrauchs theoretischer Begriffe – am Beispiel des politischen Urteils
Hannah Van Reeth, Christian Heuer: „Das ging wirklich mit der Theorie los“. Über Möglichkeiten theoretischer Forschung in der Geschichtsdidaktik
Forum
Stephan Podes: Gesellschaftswissenschaftliche Urteilsbildung in der Diskussion
Chiara Fuerst, Matthias Zimmermann: Lernförderliche Klassengespräche im Geschichtsunterricht gestalten – Erprobung und Evaluation eines Planungsinstrumentes für Lehrpersonen
Christian Buschmann, Philipp McLean: Planspiele im Geschichtsunterricht! Überlegungen zum fachdidaktischen Nutzen reflexiver Phasen
Debatte
Martin Buchsteiner: Digitale Spiele im Geschichtsunterricht – eine (geschichtsdidaktische) Überforderung?
Buchbesprechungen
Johannes Drerup (2021): Kontroverse Themen im Unterricht. Konstruktiv streiten lernen (von Jule Bärmann, Merle Behnke und Christian Thein)
Dirk Witt, Johann Knigge-Blietschau und Christian Sieber (Hg.) (2021): Leitfaden Referendariat im Fach Gesellschaftswissenschaften (von Alexandra Binnenkade)
Günther Seeber u.a. (2021): Das Schulfach Wirtschaft. Effekte auf die ökonomischen Kompetenzen und Einstellungen Jugendlicher in Klasse 7 und 8 (von Birgit Weber)
Abstracts
Autorinnen und Autoren dieses Heftes
Dr. Martin Buchsteiner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Fachdidaktik des Historischen Instituts der Universität Greifswald.
Christian Buschmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Didaktik der Geschichte an der Universität Frankfurt/M.
Chiara Fuerst ist ausgebildete Geschichtslehrerin für die Sekundarstufe I und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Lernförderliche Klassengespräche im Geschichtsunterricht planen“ (finanziert vom Forschungsfonds zur Hundertjahrfeier der Universität Fribourg).
Dr. phil. habil. Christian Heuer ist Professor für Geschichtsdidaktik an der Karl-Franzens-Universität Graz.
Prof. Dr. Detlef Kanwischer ist Professor für Geographie und ihre Didaktik am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt.
Dr. Philipp McLean ist Akademischer Rat im Bereich Geschichtsdidaktik an der Universität zu Köln.
Dr. Stefan Müller ist Professor am Fachgebiet Soziale Probleme, Bildung und Gesellschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences und Privatdozent für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Isabelle Muschaweck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt.
Dr. Mirko Niehoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Didaktik der politischen Bildung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Dr. Stephan Podes ist Regierungsschuldirektor a. D.: Referent in der Abteilung für Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Tübingen, u. a. verantwortlich für die Fachaufsicht der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer an den allgemein bildenden Gymnasien.
M. A. Melanie Richter-Oertel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History (frzph) und Doktorandin an der Europa-Universität Flensburg.
BEd. Hannah Van Reeth ist studentische Mitarbeiterin für Forschung an der Karl-Franzens-Universität Graz.
Dr. Matthias Zimmermann ist Lektor am Zentrum für Lehrerbildung der Universität Fribourg und Lehrbeauftragter an der PH St. Gallen.
Wie steht
es um Theorieentwicklung und -diskussion in den gesellschaftswissenschaftlichen
Fachdidaktiken? Die Beiträge des Hefts fragen nach Möglichkeiten theoretischer
Forschung, nach dem Verhältnis von pädagogischen und fachwissenschaftlichen
Theorien und nach jenem von Fachlichkeit und Transdisziplinarität in den
Gesellschaftswissenschaften. Dazu kommen Beiträge zu Dialektik und
Urteilsfähigkeit.
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Warum sollen Schüler*innen Geschichte lernen? Im Kontext dieser Frage steht das zentrale Ziel des Erwerbs Mündigkeit durch historische Bildung im Vordergrund. Der Autor stellt zudem ein emanzipatives Mündigkeitsverständnis vor, das auch über den Geschichtsunterricht hinaus Schüler*innen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung im Bildungsprozess aufzeigt.
"Die Ideen der Nationalökonomen und politischen Philosophen, gleich ob sie nun wahr oder falsch sein mögen, sind von weit größerem Einfluss, als man gemeinhin annimmt. In Wirklichkeit wird die Welt von nichts anderem regiert”, so formulierte es John Maynard Keynes. In diesem Vertiefungsheft sind Schüler*innen der Sekundarstufe II eingeladen, sich mit klassischen, wie neueren ökonomischen Theorien und Kontroversen, sowie deren Weltwirksamkeit auseinanderzusetzen: von der grundlegenden Frage, wie Menschen Entscheidungen treffen und was sie antreibt (homo oeconomicus vs. homo culturalis), über eine Bandbreite ökonomischer Theorien im Hinblick auf Wohlstand und Verteilung (Smith, Marx, Hayek, Ostrom, Gottschlich), aktuellen Entwicklungen wie der feministischen Ökonomie, bis hin zu den idealtypischen Gegenpositionen in der Wirtschaftspolitik: dem angebotsorientierten und dem nachfrageorientierten Ansatz (Friedman vs. Keynes).
zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften
Die Zeitschrift bietet ein gemeinsames wissenschaftliches Forum für die Didaktiken im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Sie befasst sich mit fachspezifischem und mit fächerübergreifendem Lehren und Lernen und schlägt Brücken zwischen den Didaktiken der gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen Geographie, Geschichte, Politik und Wirtschaft , der Erziehungswissenschaft und der Lehrerbildung.Weitere Informationen zur zdg Für Studierende und Referendar*innen bieten wir die zdg für die Dauer der Ausbildung zum halben Preis an. Bitte reichen Sie zeitnah eine entsprechende Bescheinigung nach.Kündigung 8 Wochen (30. April bzw. 31. Oktober) vor dem Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.
Heft 2/2021 der zdg versammelt vielfältige Beiträge zu „Erinnerung“, etwa phänomenologische Überlegungen, Gesellschaftsanalysen, der erinnerungskulturelle Umgang mit Holocaust sowie Reflexionen zum Zusammenhang von Digitalität und Erinnerung.
Identität ist in jüngster Zeit mehr und mehr von einem individual- und sozialpsychologischen Konzept zu einem politischen Kampfbegriff geworden, mit dem um Verhältnisbestimmungen von Diversität und Integration in der Gesellschaft gerungen wird. Die damit verbundenen Probleme und Kontroversen haben inzwischen auch die Fachdidaktiken und die Bildungspraxis erreicht. Das Heft fragt nach der grundsätzlichen Relevanz dieses Themas für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, insbesondere mit Blick auf demokratische Identität und auf Antisemitismus, und stellt identitätsbezogene Forschungen zu S…
Fächerintegration ist in den Gesellschaftswissenschaften ein gängiges Muster der Fächerorganisation, wovon Fächer wie Geschichte-Politik, Politik-Wirtschaft, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Geographie-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Recht, Sozialkunde oder Gesellschaftslehre ein beredtes Zeugnis geben. Diese offerieren – integriert oder spezialisiert - Lernenden ähnliche Felder gesellschaftlicher Realität mit zum Teil gleichen Fragestellungen, aber auch divergierenden Perspektiven. Es existieren also gute Gründe, sich den Chancen und Herausforderungen der Fächerintegration konzeptionell und empirisch zu nähern. In diesem Heft entwickeln Frederica Valsangiacomo, Dagmar Widorski und Christine Künzli David eine Systematik „transversalen Unterrichtens“ aus bildungstheoretischer Perspektive. Entzündet am Streit um ein Fach Wirtschaft befasst sich Thorsten Hippe mit dem „Kampf der Kulturen“ zwischen Politik- und Wirtschaftsdidaktik, dem er ein Plädoyer einer „bedingten Interdisziplinarität“ gegenüberstellt. Oliver Plessow analysiert das Verhältnis „Geschichte mit Gemeinschaftskunde“ an baden-württembergischen Berufsgymnasien in Bildungsplan und Zentralprüfungen auf gelingende Fächerintegration, während Volker Rexing die politische Bildung in die Lernfeldkonzeption der beruflichen Bildung integriert. Eine Bestandsaufnahme der gesellschafts¬wissen¬schaftlichen Fächerverbünde sowie einen Diskussionsvorschlag möglicher Perspektiven legt Thomas Brühne vor. Auch in den Forumsbeiträgen existieren inhärente fächerübergreifende Bezüge, wenn Marie Winckler die Berücksichtigung der interdisziplinären Gender Studies für die politische Bildung einfordert, Carsten Quesel, Carmine Maiello und Susanne Burren den Lernzuwachs in Miniunternehmen aus psychologischer und soziologischer Perspektive evaluieren und Alexandra Binnenkade mit der „Quelle“ ein zentrales geschichtsdidaktisches Konzept – auch mit Bedeutung für andere gesellschaftswissenschaftliche Fächer – hinterfragt. Auch die Werkstattbeiträge liefern einen lebendigen Einblick in das Schwerpunktthema. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.
Komplexe Zusammenhänge in der Geschichte, Geographie, Politik, Wirtschaft lassen sich selten „als solche“ didaktisch behandeln; sie müssen vielmehr reduziert, verdichtet und verständnisintensiv werden. Dies kann durch Modelle, Bilder oder Erzählungen geschehen, die auf spezifische Adressaten gerichtet und von diesen sinngemäß interpretiert werden. Der Sinn kann in der Sache liegen und in der Hinsicht des Betrachters – eine Sinn-Vorgabe oder eine Sinn-Zugabe. Die Narration ist ein traditionelles Format zum Verstehen von Welt, als Prozess oder als Produkt. Hier wird über einen Fall/eine Figur/eine Idee Verständnis in einer Sache ermöglicht und das Entschlüsseln, Verallgemeinern und Relativieren geübt. Neben der Kleinen Erzählung zum Verstehen von Großen Erzählungen gibt es eine weitere Dimension des Begriffsfeldes, nämlich das Narrativ. Narrative können als Erklärungsansätze (im Sinne von Paradigmen) erkannt werden, die für ein bestimmtes Raum-Zeit-System als gültig erscheinen, z.B. national, gruppenspezifisch, zeitweilig, triftig und funktional, aber niemals als universal und endgültig. Auch dies gilt es als Muster zu durchschauen und zu dekonstruieren. Das Heft „Narrationen“ bietet dazu eine Reihe theoretisch gegründeter Anwendungen. Diese sind konzeptionell oder empirisch gefasst; sie sollten zugleich Impulse setzen zur Entwicklung einer reflexiven, dekonstruktiven und narrativen Kompetenz. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.
Symbole lösen im Denken der sie wahrnehmenden Menschen Bedeutung aus. Sie stellen etwas dar, was ohne ihre Hilfe nicht oder nur schwer bedacht oder erfasst werden kann. Menschen können nur auf Grundlage von Symbolen die Welt und die Gesellschaft verstehen. Dementsprechend spielen Symbole im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht eine grosse Rolle. Im Heft „Symbole“ beschäftigt sich Carl Deichmann mit dem Zusammenhang zwischen den politischen Symbolen, dem politischen Bewusstseinsbildungsprozess, der politischen Kultur und der Politikdidaktik und plädiert für einen „weiten Symbolbegriff“. Michele Barricelli berichtet über symbolisches Geschichtsbewusstsein in Prozessen des urbanen Wandels und stellt die zentrale Bedeutung von Symbolen für Geschichte heraus. Mirka Dickel und Antje Schneider stellen ein Studienprojekt auf Sylt vor und machen klar, wie wichtig es in Wissenschaft und Unterricht ist, vom Primat der Frage auszugehen. Iris Groschek schliesslich zeigt in ihrem Beitrag auf, wie der Koffer zum Symbol für die Shoah wurde und wie er in verschiedenen Ausstellungen als Symbol eingesetzt wird. In einem Forumsbeitrag beschäftigt sich Wolfgang Sander mit Transformationen und Grenzen der Kompetenzorientierung, und in der Rubrik Werkstatt berichten verschiedene Autorinnen und Autoren aus Lehre, Forschung und Entwicklung im Bereich der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften. Pointierte und profilierte Buchbesprechungen runden das Heft ab. Die Bezugsbedingungen im Abo finden Sie hier.