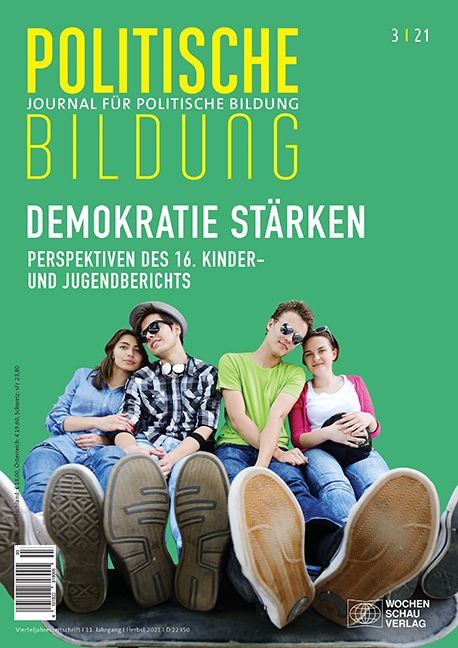Soziale Arbeit – Begegnung mit Grenzen. Social Work – The Encounter with Borders
- herausgegeben von
- Friedrich W. Seibel, Armin Schneider, Andreas Thimmel
- unter Mitarbeit von
- Anna Aluffi Pentini, Annamaria Campanini, Sanela Bašić, Teresa Bertotti, Franz Hamburger, Jan Hesselink, Ewa Kantowicz, Anette Kniephoff-Knebel, Karl Heinz Lindemann, Walter Lorenz, Kurt-Peter Merk, Ewa Marynowicz-Hetka, Alex Roberston, Peter Schäfer, Stefan Schäfer, Armin Schneider, Friedrich W. Seibel, Marc-Ansgar Seibel, Andreas Thimmel, Joachim Wieler, Nino Žganec
Soziale Arbeit als Profession und wissenschaftliche Disziplin arbeitet mit und über Grenzen hinweg: Grenzen zwischen Individuen und Gruppen, zwischen Staaten, Gesellschaften und Kulturen. Soziale Arbeit zwischen Interkulturalität, Transnationalität, Profession und gesellschaftlichem Wandel bringt angesichts aktueller Herausforderungen immer wieder neue Überlegungen und Facetten in den wissenschaftlichen und professionellen Diskurs. Die Autor*innen der hier versammelten deutsch- und englischsprachigen Beiträge sind inspiriert von der Person und dem Werk von Günter J. Friesenhahn.Social Work…
| Bestellnummer: | 41309 |
|---|---|
| EAN: | 9783734413094 |
| ISBN: | 978-3-7344-1309-4 |
| Reihe: | Wochenschau Wissenschaft |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Auflage: | 1. Auflage |
| Seitenzahl: | 352 |
- Beschreibung Soziale Arbeit als Profession und wissenschaftliche Disziplin arbeitet mit und über Grenzen hinweg: Grenzen zwischen Individ… Mehr
- Inhaltsübersicht ARMIN SCHNEIDER, FRIEDRICH W. SEIBEL, ANDREAS THIMMEL Einleitung ARMIN SCHNEIDER, FRIEDRICH-W. SEIBEL, ANDREAS THIMMELIntro… Mehr
- Autor*innen Aluffi Pentini, Anna, PhD,Associate Professor of General and Social Pedagogy at the Department of Educational Sciences of th… Mehr
- Stimmen zum Buch „Wer mehr über die Funktion, die Konstitutionsmodi und die Wirkung von Grenzen erfahren will, dem/der kann die Lektüre des S… Mehr
Introduction
Crossing Borders: Migration and Interculturality
Frauen in interkulturellen Spannungen – von Leiden zu Kompetenz
Die Familie der Migrantinnen und Migranten: Konfrontation der Einwanderungsgesellschaft mit ihrer Vergangenheit
Social healing in the aftermath of collective trauma
Reflexive Internationalität in einer postmigrantischen Gesellschaft
Working Accross Borders: Inter- and Transnational Social Work
Social work education between internationalisation and indigenisation
Activity of International and National Associations of Schools of Social work for creating a culture of professionalisation of social work
The transcultural and transversal dimension of European cooperation in constructing a vision of social professions and their activity in the field of social/societal work
Nurturing the community of social work educators in Europe. The role of organisations and key people
Vom „Mauerfall“ zu internationaler und multikultureller Sozialer Arbeit Begegnungen ‚mit/ohne‘ Grenzen nach dreißig Jahren seit der Gründung der Fachhochschule Erfurt
Im Spannungsverhältnis zwischen Universalisierung und Kontextualisierung: Internationale Kooperation und grenzüberschreitende Perspektiven in der Sozialen Arbeit von den Anfängen bis ins digitale Zeitalter
Border Encounters of Professional Social Work
Grenzen der Disziplin überschreiten – zur Stärkung der eigenen Disziplin
Störpotentiale und Bruchstellen in Hilfeprozessen. Eine systemische Betrachtung
Revisiting Nils Christie and his ideas against professionalisation of Restorative Justice*
Soziale Arbeit in gespaltener Gesellschaft – deutsch-französische Perspektiven zum Verständnis sozialer Spaltung
Building Bridges Accross Borders: New Approaches to Social Work
Fünfzig Jahre Fachbereich Sozialwissenschaften: Grenzen und Grenzakteure
Trends, Developments and Problems in the Governance of Social and Health Services. An International Perspective
Grundeinkommen nur für „Minderjährige“
Social Work as a political actor – Konzepte und Studien zu politischem Handeln Sozialer Arbeit in internationaler Perspektive
Social work – Europe – the Corona Crisis: which way forward?
Das Ausbildungsprogramm Koblenz 1971 und seine Aktualität
The Koblenz Course Model 1971 and its Lasting Relevance
Associate Professor of General and Social Pedagogy at the Department of Educational Sciences of the University of Roma Tre (I), where she coordinates the course of Studies for Nursery and Early Childhood Educators and teaches Social Pedagogy and Theory and Methods of Pedagogical Counselling. Her main publications focus on these issues and on the themes of interculturality, anti-racism and counselling. For many years she has been involved in pedagogical planning and supervision of operators and teachers and consultancy for immigrant families, promoting an integrated relationship between theory and educational action.
Assistant Professor at the Faculty of Political Sciences in Sarajevo (BiH). Her research interests are: social work history, social work education, welfare state, poverty and social exclusion, domestic and gender-based violence, post-conflict peace-building. She has been a fellow of the Academic Fellowship Programme, Open Society Institute (2010-2014), and Konrad Adenauer Foundation (2002-2004). In 2009 she was elected and in 2013 re-elected to the Executive Committee of the European Association of School Social Work (EASSW), where she assumed the duty of the Secretary of the Association (2015-2017).
Associate Professor of Social Work at the University of Trento (I). Before starting the academic career, she worked for more than 20 years in the field of child protection as professional social worker and manager. Her current research interests focus on professional ethics, quality of social work in the field of child welfare, relation between professionals and organization and social work education. She is currently President of the European Association of Schools of Social Work (EASSW).
Milano Bicocca University (I). President of IASSW and she was coordinator of the Thematic network “EUSW-European Social Work” and President of EASSW.(She has taught in many countries in the world (especially Europe and China); has served as an international examiner for MA and PHD programs, as well as curriculum development expert in Portugal and for European ESCO projects. She has authored many publications in several languages, and she serves as an editorial board member of many international social work journals. Social work education at international level is, at present, a great area of research and interest.
von 1978 bis 2011 Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (D), im Ruhestand seit dem 1.10.2011
Sozialarbeiter, Pädagoge, Sozialwissenschaftler (Sozialgerontologe), Jurist, Supervisor und Coach; vormals Dozent/Supervisor/Trainer an der FH Saxion – Enschede (NL), FB Soziale Arbeit und Jura sowie Gastdozent an der FH Koblenz, Neubrandenburg, Kiel und Düsseldorf. Seit 2006 freiberuflich aktiv als Fort- und Weiterbildungsreferent, Trainer/Supervisor/Coach in den Grundlagen und (wirksamen) Methoden der Sozialen Arbeit, in den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg.
Academic teacher and researcher at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (PL) - Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy. She has been engaged in the professional education and training for social pedagogues and social workers since 1995, taking an active part in developing programs for social work education at her university and research projects, participating many professional conferences and seminars in Poland and abroad. She is the author of many publications (over 100) and study materials related to social pedagogy and social work concepts, models of education for social professions, protection on child rights, life quality, empowerment, exclusion/inclusion in social work, child’s care in welfare system, social support for vulnerable groups, family at risk, etc. She works as a volunteer social work expert, in the local social institutions in her home town, participating in elaboration of some welfare system strategies and social work projects. She is a member of EASSW and President of Polish Association of Schools of Social Work (PASSW).
Professorin im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz (D) für den Bereich Wissenschaft der Sozialen Arbeit unter besonderer Berücksichtigung von Diversität in der Sozialen Arbeit. Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Diversity, Geschlechterforschung, Internationalisierung in der Sozialen Arbeit, Innovation in der online-basierten Lehre und Didaktik.
Diplom-Soziologe, Diplom-Pädagoge und Diplom-Sozialarbeiter, Supervisor, Coach und Organisationsberater (DGSv und DGSF) sowie Seniorcoach und Lehrcoach (DCV), vormals an der Hochschule Koblenz (D), Fachbereich Sozialwissenschaften.
Contract professor social work Charles University, Prague (CZ), and Free University of Bozen/Bolzano (I).
Social pedagogue, Professor of the Humanities, D.H.C. University of Ostrava; Director (1987-2019) of the Department of Social Pedagogy at Lodz University; Doyen of Faculty of Educational Sciences University of Lodz (PL) (1991-1996); Member of the Pedagogy Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences (2003-2011), President of the Polish Association of Schools of Social Work (1991-2011), Member of the Board and Vice president of EASSW (1989-1997); Member of the Board of ECCE (2005-2016); President of the ERCSW (2006-2019). Author of many works in the field of social pedagogy, in which she discusses: tools for analysis of the field of activity of a social pedagogue; training for the field of practice; historical processes of socio-cultural thought and development of practice.
Professor für Recht in der Sozialen Arbeit an der HS Koblenz (D).
taught at Edinburgh University (UK) until retirement in 2006. Canadian Department of Health and Welfare Visiting Fellow at McMaster University, Ontario in 1977 and Professore di Contratto at various Italian universities from 1983-2015. He has published extensively on: health policy; care of the elderly; treatment of juvenile offenders; and gauging the quality of life.
Ass.jur., Dipl.-Krim., Mediator. Professur für Familien- und Kinder- und Jugendhilferecht am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach (D).
Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der TH Köln (D). Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte und Theorien Sozialer Arbeit, politische Theorie und Bildungsphilosophie sowie die Praxis politischer Bildung und internationaler Jugendarbeit.
lehrt und forscht an der Hochschule Koblenz (D) zu den Themen Management, Forschung, Nachhaltigkeit und Organisationsethik. Er leitet das Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB) und ist Dekan des Fachbereiches Sozialwissenschaften.
lehrte von 1971 bis 2006 im Fachbereich an der Hochschule Koblenz (D). Er war zuletzt der Leiter des Studiengangs „European Community Education Studies – E.C.E.S.“ und „Jean Monnet Professor“ für „Interdisciplinary European Studies“ (beides: 1996-2006). Er war Mitbegründer des ECCE, dessen erster Präsident von 1985 an und ab 1995 der Geschäftsführer; Manager des Thematischen Netzwerks für soziale Professionen „ECSPRESS“ im SOCRATES-Programm (1996-1999).
Dipl.-Päd. Dipl.-Theol., Professur für Theorien und Konzepte (in) der Sozialen Arbeit und Prodekan, Fachbereich Sozialwissenschaften, Hochschule Koblenz (D). Arbeits-/Forschungsgebiete: Theorien und Konzepte (in) der Sozialen Arbeit, Sozialtheorie, Sozialphilosophie, Sozialethik sowie Posttraditionale Sozialformen/Jugendszenen und Jugendarbeit.
Professur für Wissenschaft der Sozialen Arbeit an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Köln (D). Leiter des Forschungsschwerpunktes Nonformale Bildung.
Diplom-Sozialarbeiter (FH) und Master of Social Work (MSW und ACSW). Psychodramaleiter und Supervisor. – Fachhochschule - University of Applied Sciences – Erfurt (D). Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. – Lehrgebiete: Methoden und Institutionen Soziale Arbeit. Berufsgeschichte und Internationalisierung Sozialer Arbeit. Forschungsschwerpunkte: Biografie Arbeit und Exilforschung zu verfolgten und vertriebenen Sozialarbeiter*innen während der NS-Zeit. – Lehrbeauftragter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (2009 – 2017) und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2019). Mitglied des wissenschaftlichen Beirate s des Alice-Salomon-Archivs Berlin und des Beirates des Falk-Vereins e.V. Weimar.
Full Professor – Chair for Social Work Theory and Methods, University of Zagreb (HR), Faculty of Law, Department of Social Work. Member of the Executive Committee of the European Association of Schools of Social Work (EASSW) (2011 – 2015) and President of the European Association of Schools of Social Work (EASSW) (2015 – 2019). His research interests are: community social work, social work ethics and human rights, organization of social services.
Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein
Wir erleben aktuell zunehmend demokratiegefährdende politische Tendenzen hin zu den Extremen: Demokratiefeindliche Parteien, aber auch fundamentalistische Gruppen gewinnen an Zuwachs, während viele Menschen, gerade Jugendliche, an Halt verlieren. Es ist eine unserer wichtigsten Herausforderungen, diesen Strömungen entgegenzuwirken.Der Band führt aus Sicht von Jugendsozialarbeit und politischer Bildung Ansätze der Primärprävention gegen Antisemitismus, Rassismus und religiösen Fundamentalismus zusammen. Sie beruhen auf einer wissenschaftlichen Reflexion und fachpolitischen Einordnung der Praxiserfahrungen aus dem innovativen Bundesprogramm RespektCoaches. Konkrete Beispiele zeigen, wie es gelingt, die Lebenswelt junger Menschen, ihre Suche nach Identität und Religion einzubeziehen und Partizipation zu ermöglichen.Das Buch richtet sich an alle, die mit oder für Jugendliche arbeiten und an aktuellen Fachdebatten im Themenfeld Prävention interessiert sind. Insbesondere pädagogischen Fachkräfte in Jugend- und Bildungsarbeit, in der Schulsozialarbeit und in den Jugendmigrationsdiensten kann es als Anregung und Weiterbildung dienen.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, in jeder Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat einen „Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe“ vorzulegen. Im November 2020 wurde der von einer unabhängigen Kommission interdisziplinärer Expert*innen erarbeitete Bericht zum Thema „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf fast 700 Seiten bietet der Bericht einen systematischen, empirisch untermauerten, umfassenden Bericht zur politischen Bildung junger Menschen. Diese Ausgabe des "Journal" möchte die Fachöffentlichkeit mit Erkenntnissen des Berichts näher bekannt machen. Dabei hat sich die Redaktion entschieden, den Bericht primär aus der Perspektive der organisierten außerschulischen politischen Jugendbildung in den Blick zu nehmen.
Angesichts von (Re-)Nationalisierungsprozessen in der Gesellschaft erscheint eine kritische politische Bildung wichtiger denn je. Das Feld der Internationalen Jugendarbeit kann hierbei besondere Lernmomente bieten, in denen die Teilnehmenden sich und ihre Perspektiven reflektieren und erweitern und so eine Vorstellung von sich als Weltenbürger*innen ergründen können. Doch wer nimmt Teil am „Blick über den Tellerrand“? Und mit welchen Erfahrungen und neuen Selbstverständnissen kommen die Jugendlichen zurück? Basierend auf qualitativen Interviews und einer intersektionalen Mehrebenenanalyse wird das Feld anhand ausgewählter diversitätsbewusster Projekte aus dem Bereich der internationalen Jugendbegegnungen sowohl aus Sicht der Teilnehmer*innen als auch aus Sicht der Teamer*innen beleuchtet. Hierbei werden Projekte fokussiert, die sich bewusst an Jugendliche wenden, die sich aus Sicht formalisierter Bildung eher als „Bildungsbenachteiligte“ beschreiben lassen. Diese sind auch nach jahrelangen Versuchen, das Stigma von teuren Projekten für privilegierte Jugendliche zu überwinden, noch immer marginalisiert in der Internationalen Jugendarbeit zu finden, obwohl das Interesse an den Projekten milieuunabhängig vorhanden ist. Ulrike Becker zeigt in ihrem Band, welche Chancen differenzsensible Projekte bieten und vor welchen Herausforderungen sie dennoch stehen. Damit eröffnet sie neue Erkenntnisse für das Feld einer diversitätsbewussten Internationalen Jugendarbeit.
Wochenschau Wissenschaft
Janusz Korczak gilt als Pionier der Kinderrechte. Dieser Band bietet eine fachübergreifende Auseinandersetzung mit der Frage nach der Anschlussfähigkeit von Korzcaks Ideen für Gesellschaften des 21. Jahrhunderts.
Michael Sauer ist einer der bekanntesten Geschichtsdidaktiker Deutschlands, der zu vielen Aspekten der Disziplin publiziert hat. In dieser Festschrift greifen Kolleginnen und Kollegen Sauers Impulse auf und setzen sich damit auseinander.
In diesem Werk analysiert der Autor diskursanalytisch die Subjektgeschichte der Politischen Bildung von 1955 bis 1980. Dabei beleuchtet er präferierte sowie marginalisierte Subjektkonstruktionen und ihre systematischen Ausschlussprozesse.
Der Sammelband greift machtkritische und intersektionale Diskurse sowie damit verbundene offene Fragen auf und bündelt innovative Beiträge einer interdisziplinären Tagung anlässlich der Pensionierung von Bärbel Völkel.
Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und Transformation steht das historische Lernen vor vielfältigen Herausforderungen und Neuorientierungen. Mit den Themenfeldern Digitalität, Sprache und Geschichtskultur werden einige relevante Themengebiete für zeitgemäßes historisches Lernen im 21. Jahrhundert beleuchtet.
Der Band vereint unterschiedliche Perspektiven auf Fragen demokratischer Bildung in Schule und Hochschule. Die Beiträge von gehen auf eine gemeinsame Ringvorlesung des hochschulübergreifenden Netzwerkes Bildung und Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern zurück.
Der Band diskutiert aus interdisziplinärer Perspektive soziale, emotionale und historische Dimensionen des Urteilens, stellt empirische Befunde vor und fragt nach Möglichkeiten der Urteilsbildung im digitalen Raum.
Die in "Diversität und Demokratie" versammelten Beiträge fokussieren die Zukunft der sprachlichen und politischen Bildung im Lichte gesellschaftlicher Vielfalt aus interdisziplinärer Perspektive. Sie thematisieren die Rolle der Sprache in der politischen und des Politischen in der sprachlichen Bildung und damit die Verknüpfung von edukativen Praktiken, politischen Diskursen und Sprachhandeln. Angesichts sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen - etwa in Hinblick auf Dynamiken sozialer, kultureller und sprachlicher Diversifikation, Digitalisierungsprozesse wie auch Prävention und Bewältigung vo…
Unterscheiden sich die Demokratie- und Partizipationseinstellungen von geflüchteten Schüler*innen mit und ohne internationale Familiengeschichte, die an den Berufskollegs im Ruhrgebiet beschult werden, voneinander?
Kinder haben ein Recht auf Politische Bildung. Doch häufig werden ihnen politische Themen nicht zugetraut und das Politische ihrer Lebenswelt negiert. Die Berichte der Lehrer*innen in diesem Band geben Einblicke in die vielfältigen Interessen und Fragen von Kindern zu aktuellen und vergangenen Krisen und Konflikten. Die kindlichen Fähigkeiten und wichtigen Potentiale Politischer Bildung werden dabei jedoch weitgehend unterschätzt. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie eine hohe Arbeitsbelastung, Defizite in der sozialwissenschaftlichen Lehramtsausbildung oder fehlende Angebote der Fachdida…
Der konfessionelle Religionsunterricht ist positionell. Wie kann ein solches Fach Indoktrination vermeiden und Kontroversität ermöglichen? An unterschiedlichen Themenbeispielen – Klimaschutz, Wirtschaftsethik und Verschwörungserzählungen – diskutiert der Band diese Frage. Auf der Basis interdisziplinärer Perspektiven wird ein religionspädagogisches Konsentpapier ("Schwerter Konsent") entworfen.
Der Band bietet pädagogische Überlegungen, die angesichts vielfältiger Krisen dazu beitragen, die Gefahr der Distanz zwischen Bürgerschaft und Demokratie zu verringern, Krisenerscheinungen als Lernanlässe zu verstehen und produktiv damit umzugehen.
Der Band versammelt Impulse zum Diskursstand sowie empirische Studien und konzeptionelle Überlegungen zur Visual History und ihren Potenzialen in der historisch-politischen Bildung. Er widmet sich dabei vielfältigen Visualia und den sie betreffenden (geschichtskulturellen) Distributions- und Verarbeitungsstrategien.
Sollte Extremismusprävention ein Teil politischer Bildung sein? Diese Frage tangiert grundlegende Vorstellungen von Demokratie und politischer Bildung. Extremismusprävention basiert auf der Gegenüberstellung von Demokratie und Extremismus. Dabei gerät oft aus dem Blick, dass jedoch gerade das Verhältnis von Demokratie und Antiextremismus durch Widersprüche gekennzeichnet ist und kritisch geprüft werden muss. Ein Sicherheitskonzept, das eine Beschränkung des politischen Streits zum Schutz der Demokratie vornimmt, läuft schließlich Gefahr, Demokratie selbst zu beschränken. Dies betrifft eine politische Bildungsarbeit in und für Demokratien ebenso wie demokratische Gesellschaften insgesamt.
Bürgerbildung und Freiheitsordnung sind konstitutiv aufeinander bezogen: Nur in einer Freiheitsordnung können sich die Bürgerinnen und Bürger im anspruchsvollen Sinne bilden und nur durch gebildete Bürgerinnen und Bürger gewinnt die Freiheitsordnung ihre Stabilität und Vitalität. Ohne politisch gebildete Bürgerinnen und Bürger lässt sich eine Freiheitsordnung weder gründen noch bewahren. Daher kommt der politischen Bildung in einer Republik die Aufgabe zu, die Qualität der politischen Ordnung zur Sprache zu bringen und eine republikanische Selbstbildung zu begleiten. Diese Festschrift würdigt…
Welche Rolle spielen Verschwörungstheorien in den Programmen rechtspopulistischer Parteien? Politikwissenschaftler Christoph Schiebel legt mit seiner Dissertation eine erkenntnisreiche Analyse zur Alternative für Deutschland (AfD), der Schweizerischen Volkspartei (SVP), der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und zum Front National (FN) vor. Aus wissenssoziologischer, politik- und kulturwissenschaftlicher Perspektive stellt er wertvolle Parteiforschungserkenntnisse zu Verschwörungserzählungen vor und zeigt, welche Rolle diese bei Themen wie Überwachung, EU, Bargeldabschaffung, Migration, Sicherheit, Wissenschaft, Bildung und Medien spielen.