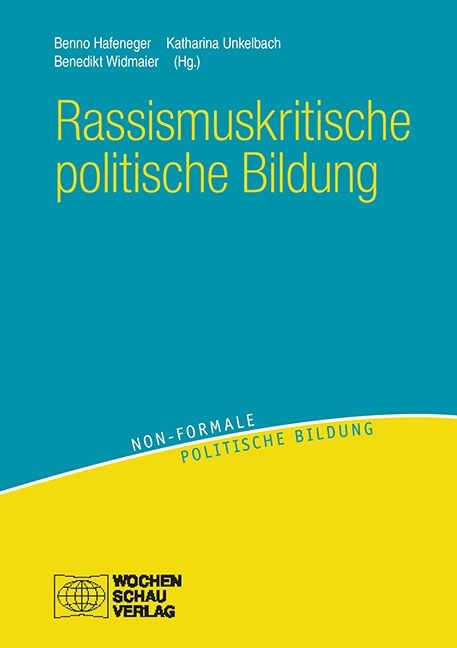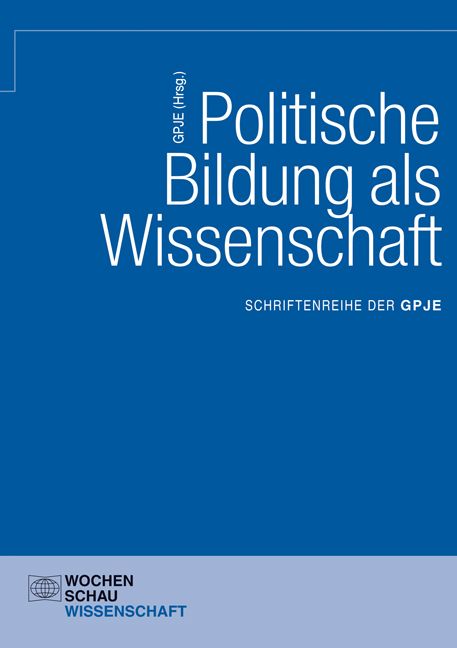Politische Bildung in der superdiversen Gesellschaft
- herausgegeben von
- Monika Oberle, Märthe-Maria Stamer
- unter Mitarbeit von
- Simon Affolter, Christiane Bertram, Marie Christin Bohla, Lukas Conrad Brandt, Anders Stig Christensen, Udo Dannemann, Oliver Emde, Tim Engartner, David Falkenstein, Simon Filler, Christian Fischer, Claudia Forkarth, Werner Friedrichs, Lara Gildehaus, Luisa Girnus, Jannis Nicolas Gluth, Eva-Maria Goll, Thomas Goll, Tilman Grammes, Dorothee Gronostay, Julia Grün-Neuhof, Katrin Hahn-Laudenberg, Inken Heldt, Christopher Hempel, Frederic Heyen, Sven Ivens, David Jahr, Annegret Jansen, May Jehle, Ingo Juchler, Steve Kenner, Stefanie Kessler, Charlotte Keuler, Marcus Kindlinger, Johanna Leunig, Sabine Manzel, Gudrun Marci-Boehncke, Daniel Maus, Verena Männer, Laura Millmann, Stefan Müller, Subin Nihjawan, Monika Oberle, Andreas Petrik, Alena Maria Plietker, Birgit Redlich, Elia Scaramuzza, Kai E. Schubert, Elisa Sobkowiak, Vera Sperisen, Michael Steinbrecher, Jutta Teuwsen, Raphaela Tkotzyk, Sören Torrau, Bastian Vajen, Thomas Waldvogel, Georg Weißeno, Christoph Wolf, Nicole Woloschuk
Der umfangreiche Band zur 21. GPJE-Jahrestagung versammelt eine Vielzahl an Forschungsperspektiven auf politische Bildung in der "superdiversen" Gesellschaft und präsentiert weitere aktuelle politikdidaktische Forschungsarbeiten.
| Bestellnummer: | 41578 |
|---|---|
| EAN: | 9783734415784 |
| ISBN: | 978-3-7344-1578-4 |
| Reihe: | Schriftenreihe der GPJE, Wochenschau Wissenschaft |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 270 |
- Beschreibung Politische Bildung steht angesichts einer enormen Komplexitätssteigerung gesellschaftlicher Vielfalt vor vielschichtigen Her… Mehr
- Inhaltsübersicht Monika Oberle, Märthe-Maria StamerEinleitung Politische Bildung in der superdiversen Gesellschaft Vera Sperisen, Simon Af… Mehr
- Autor*innen Dr. des. Simon Affolter, Wiss. Mitarbeiter am Zentrum für Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der PH FHNW, Zentrum… Mehr
Monika Oberle, Märthe-Maria Stamer
Einleitung
Politische Bildung in der superdiversen Gesellschaft
Vera Sperisen, Simon Affolter
Diversitätskritische Politische Bildung statt zugeschriebener Vielfalt
Stefanie Kessler
Habitussensibilität von politischen Bildner*innen im Umgang mit heterogenen Zielgruppen.
Ergebnisse aus zwei Forschungsprojekten
Sabine Manzel, Claudia Forkarth
Multilinguale Differenz ist (k)ein Risiko für Politisches Lernen: Eine Intervention zum sprachsensiblen Fachunterricht
Elia Scaramuzza
Superdiverse Gesellschaft, superdiverse Geschlechter?! Zum reflexiven Umgang mit Geschlechterdiversität in der politischen Bildung
Udo Dannemann, Luisa Girnus
Urban oder ländlich als Differenzierungsmerkmal für die sozialwissenschaftliche Bildung?
Julia Grün-Neuhof
Zur Sozialität Politischer Bildung
Christoph Wolf
Antisemitische Fragmente in den Vorstellungen von Politiklehrkräften
Kai E. Schubert
Wie soll Bildung gegen (israelbezogenen) Antisemitismus wirken? Direkte und indirekte pädagogische Ansätze
Christian Fischer
„Adaptivität“ und „flexible Elaborierbarkeit“ – Didaktische Kategorien für einen inklusiven Politikunterricht?!
David Jahr, Andreas Petrik
Politikunterricht inklusiv? Argumentationstheoretische und dokumentarische Rekonstruktion einer doppelten Vereinnahmung von Person und Sache im Rollenspiel
Werner Friederichs
Die Vielheit ohne das Ganze. Politische (Subjekt-)Bildungen in der UnMenge
Subin Nijhawan, Tilman Grammes
Glocalities zwischen didaktischer Reduktion und Komplexität. Globales Lernen und politische Bildung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Sekundarstufe I
Weitere aktuelle politikdidaktische Forschungsbeiträge
Annegret Jansen
Kontroversität um Nachhaltigkeit außerschulisch erfahren? Sinnbildungsprozesse von Jugendlichen im Zuge kontroverser Realbegegnungen
Ingo Juchler, Monika Oberle
Zur Mensch-Tier-Beziehung in der politischen Bildung
Thomas Goll, Eva-Maria Goll, Gudrun Marci-Boehncke, Raphaela Tkotzyk, Michael Steinbrecher, Laura Millmann, Elisa Sobkowiak
Frühe politische Bildung – Notwendigkeit, Möglichkeiten und Herausforderungen
Inken Heldt
Die digitale Transformation als Herausforderung für die Lehrer/-innenbildung. Eine Exploration der Präkonzepte angehender Lehrkräfte der Politischen Bildung
Sören Torrau
Recherchieren als Zusammenschmelzen von Nachrichten? Zur Sozialität digitaler Transformationen im Politikunterricht
Christiane Bertram
Diverses Erleben der Transformation. Die „Generation 1975“ in West- und Ostdeutschland spricht über- und miteinander. Ein Forschungs- und Transferprojekt
Bastian Vajen, Lara Gildehaus
Mathematisch-politische Bildung
Katrin Hahn-Laudenberg
Der Beitrag von politischer Bildung und Schule zur supranationalen politischen Unterstützung bei Schüler*innen
Anders Stig Christensen
Quality in social studies in Nordic countries
Dorothee Gronostay
„Erst beschreiben, dann deuten und bewerten!?“ – Befunde einer Studie zur Realisierung von Unterrichtseinstiegen mit Karikatur
Georg Weißeno
Lernen durch politische Partizipation
Steve Kenner
Young Citizens in Aktion. Rekonstruktion von Bildungserfahrungen in politischen Jugendinitiativen
Oliver Emde
„Spazierend schreiten wir voran!?“ – Stadtrundgänge als Lernarrangements von politisch positionierten, bewegungsbezogenen Akteur:innen
Monika Oberle, Johanna Leunig, Thomas Waldvogel
Kommu … What?! Wirkungen einer kommunalpolitischen Erstwählerkampagne der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
May Jehle, Tim Engartner
Implizite Deutungsmuster von Demokratie. Entscheidungsdynamiken im Kontext von Planspielen
Stefan Müller
Die Wiederentdeckung der Dialektik in der politischen Bildung
Posterpräsentationen zu aktuellen Forschungsprojekten
Thomas Goll, Eva-Maria Goll, Michael Steinbrecher, Laura Millmann, Elisa Sobkowiak, Gudrun Marci-Boehncke, Raphaela Tkotzyk
PoJoMeC: ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu "Politik, Journalismus, Medienbewusstsein – Kompetenzen von Kindern im Vor- und Grundschulalter"
Daniel Maus
Politische Bildung in der Grundschule – Bestandsaufnahme und Gelingensbedingungen
Nicole Woloschuk
Exklusion im Kontext von Migration als Ausgangspunkt für inklusive politische Bildung im Sachunterricht – Vorstellung eines qualitativen Forschungsvorhabens
Alena Maria Plietker
Inklusive Zugänge zu politischer Handlungsfähigkeit – eine Analyse von Exklusionsmechanismen in schulischer handlungsorientierter politischer Bildung
Dorothee Gronostay, Katrin Hahn-Laudenberg, Sabine Manzel, Simon Filler, Frederik Heyen, Marcus Kindlinger, Jutta Teuwsen
LArS.nrw – Lernen mit Animationsfilmen realer Szenen sozialwissenschaftlicher Unterrichtsfächer
Marcus Kindlinger
Förderung epistemischer Kognition in digitalem Lernmaterial für angehende Politiklehrkräfte
Verena Männer
Sprachbildlich Demokratie verstehen – eine rekonstruktive Studie
Lukas Conrad Brandt, Dorothee Gronostay
Welchen Lernertrag haben kompetitive vs. kooperative Unterrichtsdiskussionen? Eine quasi-experimentelle Videostudie im Politikunterricht
Jannis Nicolas Gluth
Politikdidaktisch argumentieren – ein experimenteller Vergleich der Wirkungen von Argument Maps vs. Argument Vee Diagrams im Kontext der universitären Phase der Lehrerbildung
David Falkenstein
Politik verstehen und vermitteln mit sozialen Medien? Digitalisierte Lernkontexte in der politikwissenschaftlichen Lehrkräftebildung
Christopher Hempel
Föderale Pandemiebewältigung im Planspiel – ein Praxisforschungsprojekt zur Rekonstruktion unterrichtlicher Aushandlungsprozesse
Marie Bohla, Sven Ivens, Birgit Redlich, Monika Oberle
Urbane Rückzugsräume schützen! Aber wie? Planspiele zur Auseinandersetzung mit politischen Aktionsformen
Charlotte Keuler
Schulische politische Bildung in Luxemburg: Eine qualitative Expert*innenstudie
Dr. des. Simon Affolter, Wiss. Mitarbeiter am Zentrum für Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der PH FHNW, Zentrum für Demokratie Aarau Forschungsschwerpunkte: Migrationspädagogik, Politische Bildung, Migrations- und Grenzregimeforschung
Dr. Christiane Bertram, Juniorprofessorin für Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz Forschungsschwerpunkte: Oral History und Zeitzeug:innen, Interventionsstudien, Kompetenzmessung
Marie Christin Bohla, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Demokratieforschung der Georg-August-Universität Göttingen Forschungsschwerpunkte: Politische Bildung, Linke Militanz
Lukas Conrad Brandt, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik integrativer Fächer der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Empirische Lehr-Lern-Forschung, Standardisierte Videostudien, Argumentieren und Urteilen im politischen Fachunterricht
Anders Stig Christensen, Ph.D., Lecturer at the UCL University College Denmark (Teacher education and Applied Research, Education and Social Sciences) Forschungsschwerpunkte: social science didactics, civic education, comparative education
Udo Dannemann, Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Bildung der Universität Potsdam Forschungsschwerpunkte: Theoretische Grundlagen einer Didaktik der Sozialwissenschaften und fachdidaktische Professionsforschung zu antidemokratischen Positionen und Einstellungen
Dr. Oliver Emde, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim Forschungsschwerpunkte: Politisches Lernen in außerschulischen Lernarrangements, Politische Bildung in/durch Soziale Bewegungen, Projektarbeit in der kulturellen und politischen Bildung
Dr. Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung an der Universität zu Köln Forschungsschwerpunkte: Theorie und Empirie sozioökonomischer Bildung, Vor- und Einstellungen von Lernenden, Bilingualer Politik- und Wirtschaftsunterricht
David Falkenstein, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main Forschungsschwerpunkte: Soziale Medien in der politischen Bildung, digitale Lernformate, Politik und Digitalisierung
Simon Filler, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik integrativer Fächer der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Lehrer:innenbildung, Lernen mit Animationsfilmen
Dr. Christian Fischer, Lehrer für die Fächer Sozialkunde und Geschichte, Wiss. Mitarbeiter an der Universität Erfurt Forschungsschwerpunkte: Politikdidaktische Praxis- und Aktionsforschung, Interpretative (historische) Fachunterrichtsforschung, Inklusion im Politikunterricht
Claudia Forkarth, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen Forschungsschwerpunkte: Sprachbildung im Fach Sozialwissenschaften, Politische Urteilsbildung, Lehrer:innenfortbildungen
Dr. Werner Friedrichs, Akademischer Direktor an der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Forschungsschwerpunkte: Demokratiebildung im Anthropozän, Politische Bildung im Kontext neuer Materialismen und der Radikalen Demokratietheorie
Lara Gildehaus, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Mathematik an der Universität Paderborn Forschungsschwerpunkte: Hochschuldidaktik Mathematik, Interdisziplinäre Perspektiven in Lehre und Forschung
Dr. Luisa Girnus, Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Politische Bildung der Universität Potsdam Forschungsschwerpunkte: Lernprozesse in gesellschaftlichen Wertediskursen, sprachsensibler und geschlechtergerechter Fachunterricht der Sozialwissenschaften, demokratische Bildung und Herrschaftslegitimation
Jannis Nicolas Gluth, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik integrativer Fächer der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Professionalisierung, kollaborative Lehr- Lernprozesse, Digitalität in (hoch-)schulischen Kontexten
Dr. Eva-Maria Goll, Akademische Rätin am Institut für Didaktik integrativer Fächer der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkt: Frühe politische Bildung
Dr. Thomas Goll, Professor für integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkt: Politische Bildung in der Frühen Kindheit, im Sachunterricht und in den Fächern der Sekundarstufe
Dr. Tilman Grammes, Professor für Erziehungswissenschaft unter bes. Berücksichtigung der Didaktik sozialwissenschaftlicher Fächer an der Universität Hamburg Forschungsschwerpunkte: Theorie der Didaktik, interpretative Unterrichtsforschung, historische und international vergleichende Fachdidaktik
Dr. Dorothee Gronostay, Juniorprofessorin für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt empirische Politikdidaktik an der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Unterrichtsforschung, Videostudien, Professions- und Lehrkräfteforschung
Dr. Julia Grün-Neuhof, Wiss. Mitarbeiterin am Zentrum für Arbeit und Politik der Universität Bremen und am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) Forschungsschwerpunkte: Politische Bildungs- und Transferforschung, Politische Bildung im Kontext gesellschaftlichen Zusammenhalts
Dr. Katrin Hahn-Laudenberg, Juniorprofessorin für Bildung und Demokratiepädagogik im Kontext von Migration und Integration an der Universität Leipzig Forschungsschwerpunkte: Kompetenzentwicklung, Civic and Citizenship Education, Empirische und international vergleichende Bildungsforschung
Dr. Inken Heldt, Juniorprofessorin für Politische Bildung an der Technischen Universität Kaiserslautern Forschungsschwerpunkte: Demokratie- und Menschenrechtsbildung, Medien und Digitalisierung, Vorstellungsforschung, europäische und internationale Dimensionen der Politischen Bildung
Dr. Christopher Hempel, Studienrat an einer Leipziger Sekundarschule und Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig Forschungsschwerpunkte: Didaktik des fächerübergreifenden und sozialwissenschaftlichen Unterrichts, Rekonstruktive Schul- und Unterrichtsforschung mit der Dokumentarischen Methode
Frederic Heyen, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen Forschungsschwerpunkte: Professions- und Lehrkräfteforschung, Digitalisierung im Kontext Bildung
Sven Ivens, Doktorand am Institut für Politikwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen
Forschungsschwerpunkte: EU-Bildung, digitale und analoge Planspiele
Dr. David Jahr, Wiss. Mitarbeiter am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Standort Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Forschungsschwerpunkte: rekonstruktive Schul- und Unterrichtsforschung, Didaktik der politischen Bildung (Schwerpunkt Inklusion), Theorie und Praxis des Service Learning
Annegret Jansen, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften sowie am Institut für Pädagogik der Universität Oldenburg Forschungsschwerpunkte: Politische Urteilsbildung, Außerschulisches Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung
Dr. May Jehle, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main Forschungsschwerpunkte: Bildungshistorische Fachunterrichtsforschung, Unterrichtsvideographie, Politische Bildung
Dr. Ingo Juchler, Professor für Politische Bildung an der Universität Potsdam Forschungsschwerpunkte: Außerschulische politische Lernorte, Narrationen, Mensch-Tier-Beziehung in der politischen Bildung
Dr. Steve Kenner, ist Gastdozent am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und hat den Ruf auf die TT-Professur für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten angenommen (vors. ab April 2023) Forschungsschwerpunkte: Partizipation, politische Bildung für nachhaltige Entwicklung und Digital Citizenship Education
Dr. Stefanie Kessler, Professorin für Soziale Arbeit an der IU Internationalen Hochschule am Studienort Braunschweig Forschungsschwerpunkte: Demokratie-Lernen und Politische Bildung in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit (Schule, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugend- und Erwachsenenbildung etc.), Qualitative-rekonstruktive Sozialforschung
Charlotte Keuler, Wiss. Mitarbeiterin in der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Universität Trier Forschungsschwerpunkte: schulische Demokratiebildung, politische Bildung in der Großregion und im internationalen Vergleich
Marcus Kindlinger, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Bergischen Universität Wuppertal Forschungsschwerpunkte: Lehrer:innenbildung, Epistemische Kognition
Johanna Leunig, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen Forschungsschwerpunkte: Empirische Bildungsforschung, Geschlecht und Politische Bildung, politische EU-Bildung
Dr. Sabine Manzel, Professorin für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen Forschungsschwerpunkte: Lehrer:innen-Professionsforschung, Politische Urteilsbildung, Videografie-Forschung
Dr. Gudrun Marci-Boehncke, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft/Elementare Vermittlungs- und Aneignungsaspekte an der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Medienbildung & Leseförderung entlang der Bildungskette, Demokratiebildung im Deutschunterricht
Daniel Maus, Abgeordnete Lehrkraft und Doktorand an der Abteilung Politikwissenschaft der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd Forschungsschwerpunkte: Demokratiebildung, Umgang mit Heterogenität
Verena Männer, Wiss. Mitarbeiterin im Fachbereich Didaktik der Politik und Gesellschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Forschungsschwerpunkte: Vorstellungsforschung, Demokratiebildung, Metapherntheorien und metaphernanalytische Methoden
Laura Millmann, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkt: Journalismus für Kinder Dr. Stefan Müller, Fachgebiet Soziale Probleme, Bildung und Gesellschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences Forschungsschwerpunkte: Sozialwissenschaftliche Grundlagen politischer Bildung, Reflexivität in der Lehramtsausbildung, Antisemitismusprävention
Dr. Subin Nihjawan, Wiss. Mitarbeiter am Institut für England- und Amerikastudien der Goethe-Universität Frankfurt am Main Forschungsschwerpunkte: mehrsprachiger Unterricht (insb. Politik & Wirtschaft), Bildung für nachhaltige Entwicklung, Theorie-Praxis Kooperationen zwischen Universitäten und Schule
Dr. Monika Oberle, Professorin für Politikwissenschaft/Didaktik der Politik an der Georg-August-Universität Göttingen Forschungsschwerpunkte: Empirische Lehr-Lern-Forschung, Schulische und außerschulische politische Bildung, Politische EU-Bildung
Dr. Andreas Petrik, Professor für Didaktik der Sozialkunde/ Politische Bildung am Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Forschungsschwerpunkte: Rechtsextremismus, Simulationen, Argumentationsanalyse
Alena Maria Plietker, Wiss. Mitarbeiterin im Social Lab der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung der Universität zu Köln und Promovendin am Bereich Politikwissenschaft, Bildungspolitik und politische Bildung der Humanwissenschaftlichen Fakultät Forschungsschwerpunkte: Inklusive politische Bildung, Demokratiebildung, Handlungsorientiertes Lernen
Birgit Redlich, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Demokratieforschung der Georg-August-Universität Göttingen Forschungsschwerpunkte: Politische Bildung, Radikalisierung im Jugendalter
Elia Scaramuzza, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Forschungsschwerpunkte: Geschlechterreflexive politische Bildung, Kritische Theorie politischer Bildung
Kai E. Schubert, Doktorand am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig Universität Gießen Forschungsschwerpunkte: Antisemitismus(kritik), politische Bildung, Diskursforschung
Elisa Sobkowiak, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund
Forschungsschwerpunkte: Journalismus für Kinder
Vera Sperisen, Wiss. Mitarbeiterin am Zentrum für Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der PH FHNW, Zentrum für Demokratie Aarau Forschungsschwerpunkte: Migrationspädagogik, Politische Bildung, Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitsordnungen im Kontext Schule
Dr. Michael Steinbrecher, Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Journalismus und Demokratie, Journalismus und Partizipation
Dr. Jutta Teuwsen, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Didaktik integrativer Fächer der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Lehrer:innenbildung, Lernen mit visuell basiertem Material
Dr. Raphaela Tkotzyk, Akademische Rätin a.Z. am Institut für Diversitätsstudien an der Technischen Universität Dortmund Forschungsschwerpunkte: Early Literacy & Media Education, (Frühkindliche) Mediensozialisation, Intersektionalisierung
Dr. Sören Torrau, Juniorprofessor für Didaktik der Sozialkunde / Politik und Gesellschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Forschungsschwerpunkte: Interpretative Fachunterrichtsforschung im sozialwissenschaftlichen Lernfeld, demokratische Unterrichts- und Schulentwicklung, Curriculumforschung
Bastian Vajen, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover Forschungsschwerpunkte: Bürgerschaftskonzepte, Teachers Beliefs, interdisziplinärer Politikunterricht
Dr. Thomas Waldvogel, Wiss. Mitarbeiter am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Fachreferent der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Forschungsschwerpunkte: Politische Einstellungs-, Verhaltens- und Kommunikationsforschung, Methodik und Didaktik der politischen Bildung, Methoden der Politikwissenschaft
Dr. Georg Weißeno, Professor i.R. für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Forschungsschwerpunkte: Empirische Lehr-Lern-Forschung, Theorie der Politikdidaktik, Unterrichtsforschung
Dr. Christoph Wolf, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover Forschungsschwerpunkte: Antisemitismuskritische Bildung, Verschwörungstheorien
Nicole Woloschuk, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Forschungsschwerpunkte: sozialwissenschaftlicher Sachunterricht mit Schwerpunkt auf gesellschaftliche Problemstellungen, inklusive politische Bildung im Sachunterricht, Methoden qualitativer Sozialforschung
Sie könnten auch an folgenden Titel interessiert sein
Die Autor*innen dieses neuen Bands befassen sich aus klassismuskritischer Perspektive u. a. mit sexueller Bildung, queerer Jugendbildung, Geschlechterbildung, Antisemitismus und Heteronormativität. Sie gewähren Einblicke in Empowerment-Projekte, veranschaulichen verschiedene emanzipatorische Herangehensweisen und werfen konstruktive Fragen für die Weiterentwicklung der außerschulischen politischen Bildung auf.
In den vergangenen Jahren sind Orte wie Chemnitz, Clausnitz, Heidenau und Freital als Chiffren für fremdenfeindliche Gewalt deutschlandweit und auch international bekannt geworden, ebenso wie bereits zuvor die PEGIDA-Hochburg Dresden. Zu gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz kam es im Sommer 2018 nach einer Auseinandersetzung, bei der ein Deutsch-Kubaner durch Messerstiche tödlich und zwei weitere schwer verletzt worden waren. Rechte und rechtsextreme Gruppen hatten aufgrund von Nachrichten zum Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter zu Demonstrationen aufgerufen. Im Internet wurden Falschinformationen verbreitet, wonach der Getötete eine deutsche Frau vor sexueller Belästigung durch Migranten beschützt habe. In der Folge kam es zu ausländerfeindlichen und antisemitischen Ausschreitungen, organisierte Rechte und Neonazis griffen tatsächliche oder vermeintliche Migranten, Gegendemonstranten, Polizisten sowie Pressevertreter und unbeteiligte Passanten sowie ein jüdisches Restaurant an. In den folgenden Tagen und Wochen gab es zahlreiche Demonstrationen und Gegenproteste. Mobilisiert hatten die rechtspopulistische Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“, die neonazistischen Parteien NPD, „Der III. Weg“ und „Die Rechte“, ebenso die Kameradschaftsszene, Hooligangruppen, PEGIDA und die Identitäre Bewegung. Der Verfassungsschutz Berlin sprach von einem „offenkundigen Schulterschluss“ von Rechtsextremisten mit der AfD. Zu einer handfesten Regierungskrise wurden die Ereignisse von Chemnitz durch die Causa Hans-Georg Maaßen. Als erste Vertreterin der Bundesregierung besuchte Familienministerin Franziska Giffey die sächsische Stadt. „Sicherheit heißt nicht nur gute Polizeiarbeit, sondern Sicherheit heißt auch Prävention, heißt Jugendarbeit, heißt politische Bildung, heißt Engagement und heißt Zusammenstehen“. Konkret wolle die Familienministerin deutlich mehr Geld für politische Bildung bereitstellen. Einige Tage später folgte im September 2018 die (erneute) Ankündigung eines Gesetzes zur Förderung der Demokratie. Dieses müsse klar machen: „Es ist auch die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren“. Das Programm „Demokratie leben!“ sei hilfreich, aber man müsse fragen, wie man von Modellprojekten zu einer strukturellen Förderung komme, so Giffey. Das Programm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ des BMFSFJ startete im Januar 2015. Die Fördersumme für das Jahr 2019 beträgt nach signifikantem Aufwuchs insgesamt 115,5 Millionen Euro. Zudem ist ebenfalls seit 2018 das beim BMI angesiedelte und mit 100 Millionen Euro hinterlegte „Nationale Präventionsprogramm gegen islamischen Extremismus“ in Kraft. Im Mai 2018 hatte Giffey angekündigt, „Demokratie leben!“ nach 2019 zu entfristen. Diese Programme sowie das angekündigte „Demokratiefördergesetz“ führen laut Benedikt Widmaier, dem verantwortlichen Redakteur dieser Ausgabe des JOURNAL, zu einem signifikanten Strukturwandel der non-formalen politischen Bildung in Deutschland und zu einer förderpolitischen Schieflage zwischen den Strukturen der genannten „neuen“ und der „alten politischen Bildung“, der mit den Förderungen der politischen Jugendbildung aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) sowie der politischen Erwachsenenbildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) lediglich ca. 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen. In dieser Ausgabe des JOURNAL wird der angesprochene Strukturwandel der politischen Bildung in verschiedenen Facetten diskutiert und eingeordnet.
Mit der Wirkungsstudie wird erstmals empirisch belegt, wie sich politische Jugendbildung längerfristig auswirkt und in politischen Haltungen sowie politischen Aktivitäten von Teilnehmenden niederschlägt. Dazu haben die Forscher junge Erwachsene biographisch-narrativ interviewt, die etwa fünf Jahre zuvor an Veranstaltungen und Projekten der politischen Jugendbildung teilgenommen haben. Die Analyse der Interviews und Gruppendiskussionen macht deutlich, wie sich diese Bildungserfahrungen – vor dem Hintergrund der jeweiligen Biographie – mit vorhandenen Kenntnissen und Einstellungen verknüpfen und wie sich die jungen Erwachsenen im politischen Raum verorten. Anders als im gegenwartsorientierten und emotional turbulenten Jugendalter sind junge Erwachsene erstmals in der Lage, ihre Entwicklungen und Bildungseffekte zu reflektieren und zu bilanzieren. Erstmals liegt eine träger- und veranstaltungsübergreifende bundesweite Studie vor, die Aussagen darüber erlaubt, wie Jugendliche die Anregungen und Impulse aus Veranstaltungen politischer Bildung in ihrem weiteren Lebenslauf nutzen konnten.
Wie entsteht Rassismus? Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen Sprache und Rassismus beobachten? Sollte rassismuskritische Bildung nicht eine Querschnittsaufgabe aller Bildungsarbeit sein? So steht vor dem Hintergrund neuer bundespolitischer Programme zur Extremismusprävention und Demokratieförderung nicht nur die non-formale politische Bildung vor neuen Herausforderungen, Klärungsprozessen und Selbstverständnisdebatten. Die Autorinnen und Autoren des Bandes widmen sich der vielschichtigen Ausdifferenzierung der rassismuskritischen Bildung: Neben dem Thema Antisemitismus werden auch Kolonialismus sowie Nachhaltigkeit und Globalisierung behandelt. Auch Rassismus im Kontext von Populismus und Rechtsextremismus kommt zur Sprache. Unterschiedliche Institutionen werden im Hinblick auf Rassismus (-kritik) betrachtet. Zudem finden sich im Band medienpädagogisch und -analytisch orientierte Beiträge. Dabei wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag politische Bildung leisten kann, um Rassismus präventiv und aktiv entgegenzutreten. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar - eine kurze Mitteilung an uns genügt!
Schriftenreihe der GPJE
In den letzten Jahren scheint die Geschwindigkeit gesellschaftlichen Wandels stetig zuzunehmen. Die Aufgaben, die sich daraus für die politische Bildung und ihre Didaktik ergeben, werden im 19. Tagungsband der GPJE thematisiert. Die Autorinnen und Autoren fragen danach, ob wir angesichts der zunehmenden Verflechtungen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft einen anderen Fächerzuschnitt im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld benötigen und wie die mannigfaltigen aktuellen Gesellschaftsdiagnosen für die politische Bildung fruchtbar gemacht werden können. Neben den Beiträgen zum Tagungsthema werden aktuelle Forschungsprojekte und die auf der Tagung präsentierten Poster vorgestellt. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar - eine kurze Mitteilung an uns genügt!
PAKET SCHRIFTENREIHE GPJE 2019 Immer griffbereit: Bestellen Sie im PAKET alle 18 lieferbaren Titel für Ihre Bibliothek, für Ihren Arbeitsplatz/Ihre Institution Die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die der Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen der schulischen und außerschulischen politisch-gesellschaftlichen Bildung in Forschung und Lehre dient. Die Publikationen zu den jährlichen Fachtagungen bilden den Stand der Wissenschaft zu aktuellen politikdidaktischen Themenfeldern umfassend ab. Jetzt bestellen und gegenüber dem Einzelkauf deutlich sparen! Die Schriftenreihe der GPJE: „Futter“ für den wissenschaftlichen Diskurs zur schulischen und außerschulischen politischen Bildung.
Deutschland ist ein Land, das seit mehreren Jahrzehnten von Migration und migrationsbedingten Veränderungen der Sozialstruktur geprägt wird. Bereits jetzt hat ca. 20 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Durch die hohe Anzahl von Menschen, die seit 2014 nach Deutschland gekommen sind, stellen sich umso mehr die Fragen nach dem Selbstverständnis einer pluralen (Einwanderungs-)Gesellschaft und den Folgen für die Ziele, Bedingungen und Prozesse der politischen Bildung. Der Band dokumentiert Beiträge u.a. zu folgenden Fragestellungen: Welche Folgen ergeben sich durch Migration für politische und gesellschaftliche Werte unserer Gesellschaft? Welche Themen und Fragestellungen sollten in Zukunft stärker in den Fokus der politischen Bildung rücken? Welche Methoden eignen sich besonders, um unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden?
Wochenschau Wissenschaft
Janusz Korczak gilt als Pionier der Kinderrechte. Dieser Band bietet eine fachübergreifende Auseinandersetzung mit der Frage nach der Anschlussfähigkeit von Korzcaks Ideen für Gesellschaften des 21. Jahrhunderts.
Michael Sauer ist einer der bekanntesten Geschichtsdidaktiker Deutschlands, der zu vielen Aspekten der Disziplin publiziert hat. In dieser Festschrift greifen Kolleginnen und Kollegen Sauers Impulse auf und setzen sich damit auseinander.
In diesem Werk analysiert der Autor diskursanalytisch die Subjektgeschichte der Politischen Bildung von 1955 bis 1980. Dabei beleuchtet er präferierte sowie marginalisierte Subjektkonstruktionen und ihre systematischen Ausschlussprozesse.
Der Sammelband greift machtkritische und intersektionale Diskurse sowie damit verbundene offene Fragen auf und bündelt innovative Beiträge einer interdisziplinären Tagung anlässlich der Pensionierung von Bärbel Völkel.
Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und Transformation steht das historische Lernen vor vielfältigen Herausforderungen und Neuorientierungen. Mit den Themenfeldern Digitalität, Sprache und Geschichtskultur werden einige relevante Themengebiete für zeitgemäßes historisches Lernen im 21. Jahrhundert beleuchtet.
Der Band vereint unterschiedliche Perspektiven auf Fragen demokratischer Bildung in Schule und Hochschule. Die Beiträge von gehen auf eine gemeinsame Ringvorlesung des hochschulübergreifenden Netzwerkes Bildung und Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern zurück.
Der Band diskutiert aus interdisziplinärer Perspektive soziale, emotionale und historische Dimensionen des Urteilens, stellt empirische Befunde vor und fragt nach Möglichkeiten der Urteilsbildung im digitalen Raum.
Die in "Diversität und Demokratie" versammelten Beiträge fokussieren die Zukunft der sprachlichen und politischen Bildung im Lichte gesellschaftlicher Vielfalt aus interdisziplinärer Perspektive. Sie thematisieren die Rolle der Sprache in der politischen und des Politischen in der sprachlichen Bildung und damit die Verknüpfung von edukativen Praktiken, politischen Diskursen und Sprachhandeln. Angesichts sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen - etwa in Hinblick auf Dynamiken sozialer, kultureller und sprachlicher Diversifikation, Digitalisierungsprozesse wie auch Prävention und Bewältigung vo…
Unterscheiden sich die Demokratie- und Partizipationseinstellungen von geflüchteten Schüler*innen mit und ohne internationale Familiengeschichte, die an den Berufskollegs im Ruhrgebiet beschult werden, voneinander?
Kinder haben ein Recht auf Politische Bildung. Doch häufig werden ihnen politische Themen nicht zugetraut und das Politische ihrer Lebenswelt negiert. Die Berichte der Lehrer*innen in diesem Band geben Einblicke in die vielfältigen Interessen und Fragen von Kindern zu aktuellen und vergangenen Krisen und Konflikten. Die kindlichen Fähigkeiten und wichtigen Potentiale Politischer Bildung werden dabei jedoch weitgehend unterschätzt. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie eine hohe Arbeitsbelastung, Defizite in der sozialwissenschaftlichen Lehramtsausbildung oder fehlende Angebote der Fachdida…
Der konfessionelle Religionsunterricht ist positionell. Wie kann ein solches Fach Indoktrination vermeiden und Kontroversität ermöglichen? An unterschiedlichen Themenbeispielen – Klimaschutz, Wirtschaftsethik und Verschwörungserzählungen – diskutiert der Band diese Frage. Auf der Basis interdisziplinärer Perspektiven wird ein religionspädagogisches Konsentpapier ("Schwerter Konsent") entworfen.
Der Band bietet pädagogische Überlegungen, die angesichts vielfältiger Krisen dazu beitragen, die Gefahr der Distanz zwischen Bürgerschaft und Demokratie zu verringern, Krisenerscheinungen als Lernanlässe zu verstehen und produktiv damit umzugehen.
Der Band versammelt Impulse zum Diskursstand sowie empirische Studien und konzeptionelle Überlegungen zur Visual History und ihren Potenzialen in der historisch-politischen Bildung. Er widmet sich dabei vielfältigen Visualia und den sie betreffenden (geschichtskulturellen) Distributions- und Verarbeitungsstrategien.
Sollte Extremismusprävention ein Teil politischer Bildung sein? Diese Frage tangiert grundlegende Vorstellungen von Demokratie und politischer Bildung. Extremismusprävention basiert auf der Gegenüberstellung von Demokratie und Extremismus. Dabei gerät oft aus dem Blick, dass jedoch gerade das Verhältnis von Demokratie und Antiextremismus durch Widersprüche gekennzeichnet ist und kritisch geprüft werden muss. Ein Sicherheitskonzept, das eine Beschränkung des politischen Streits zum Schutz der Demokratie vornimmt, läuft schließlich Gefahr, Demokratie selbst zu beschränken. Dies betrifft eine politische Bildungsarbeit in und für Demokratien ebenso wie demokratische Gesellschaften insgesamt.
Bürgerbildung und Freiheitsordnung sind konstitutiv aufeinander bezogen: Nur in einer Freiheitsordnung können sich die Bürgerinnen und Bürger im anspruchsvollen Sinne bilden und nur durch gebildete Bürgerinnen und Bürger gewinnt die Freiheitsordnung ihre Stabilität und Vitalität. Ohne politisch gebildete Bürgerinnen und Bürger lässt sich eine Freiheitsordnung weder gründen noch bewahren. Daher kommt der politischen Bildung in einer Republik die Aufgabe zu, die Qualität der politischen Ordnung zur Sprache zu bringen und eine republikanische Selbstbildung zu begleiten. Diese Festschrift würdigt…
Welche Rolle spielen Verschwörungstheorien in den Programmen rechtspopulistischer Parteien? Politikwissenschaftler Christoph Schiebel legt mit seiner Dissertation eine erkenntnisreiche Analyse zur Alternative für Deutschland (AfD), der Schweizerischen Volkspartei (SVP), der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und zum Front National (FN) vor. Aus wissenssoziologischer, politik- und kulturwissenschaftlicher Perspektive stellt er wertvolle Parteiforschungserkenntnisse zu Verschwörungserzählungen vor und zeigt, welche Rolle diese bei Themen wie Überwachung, EU, Bargeldabschaffung, Migration, Sicherheit, Wissenschaft, Bildung und Medien spielen.